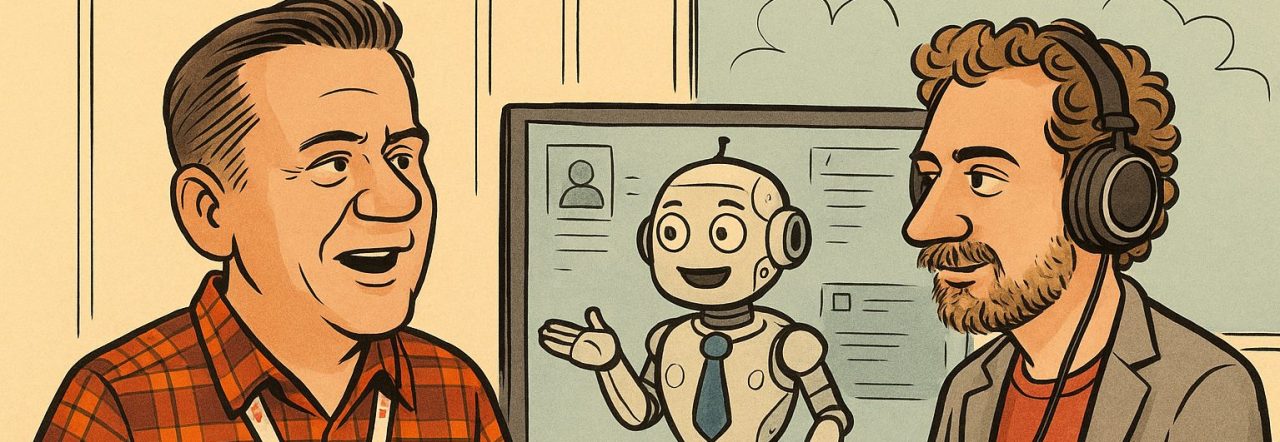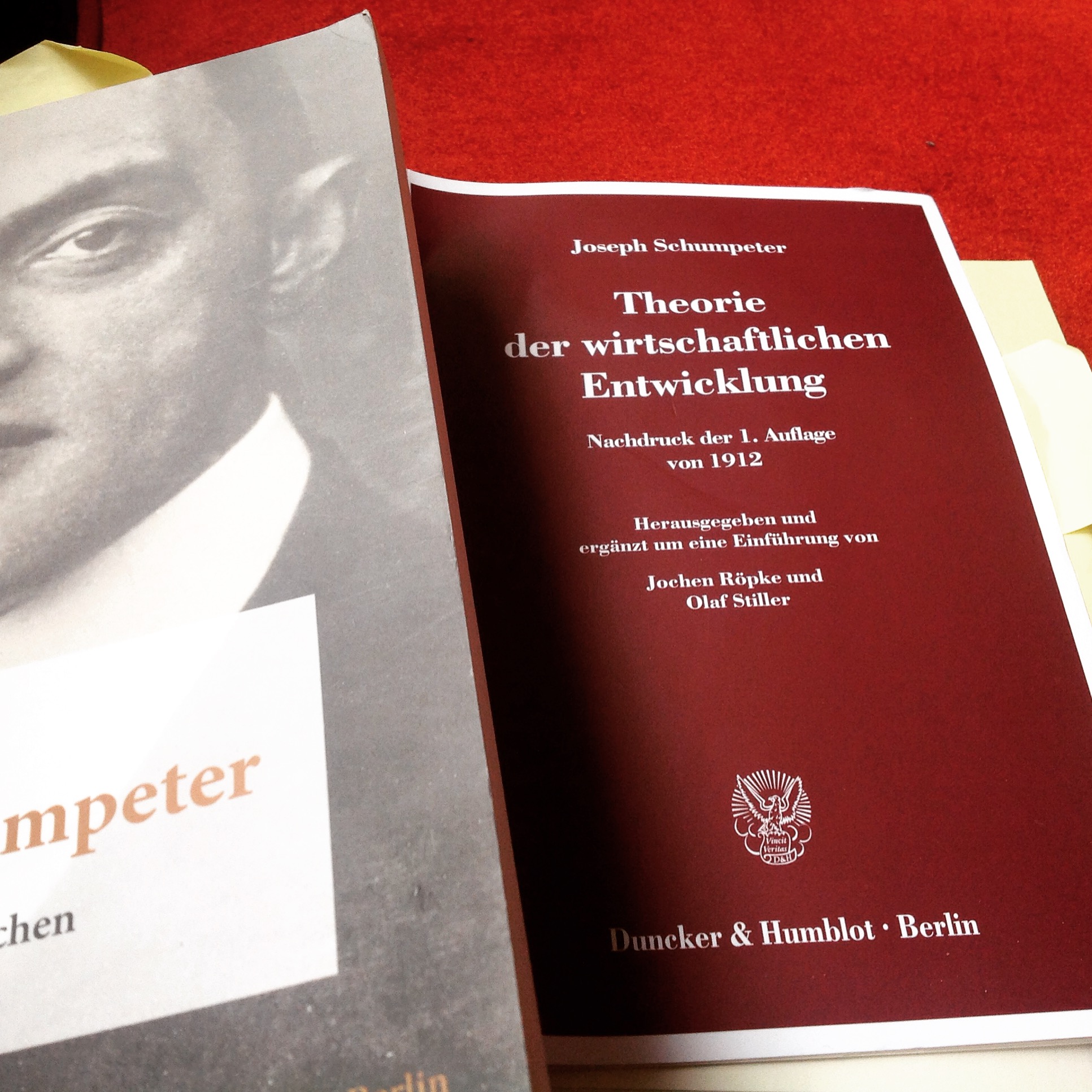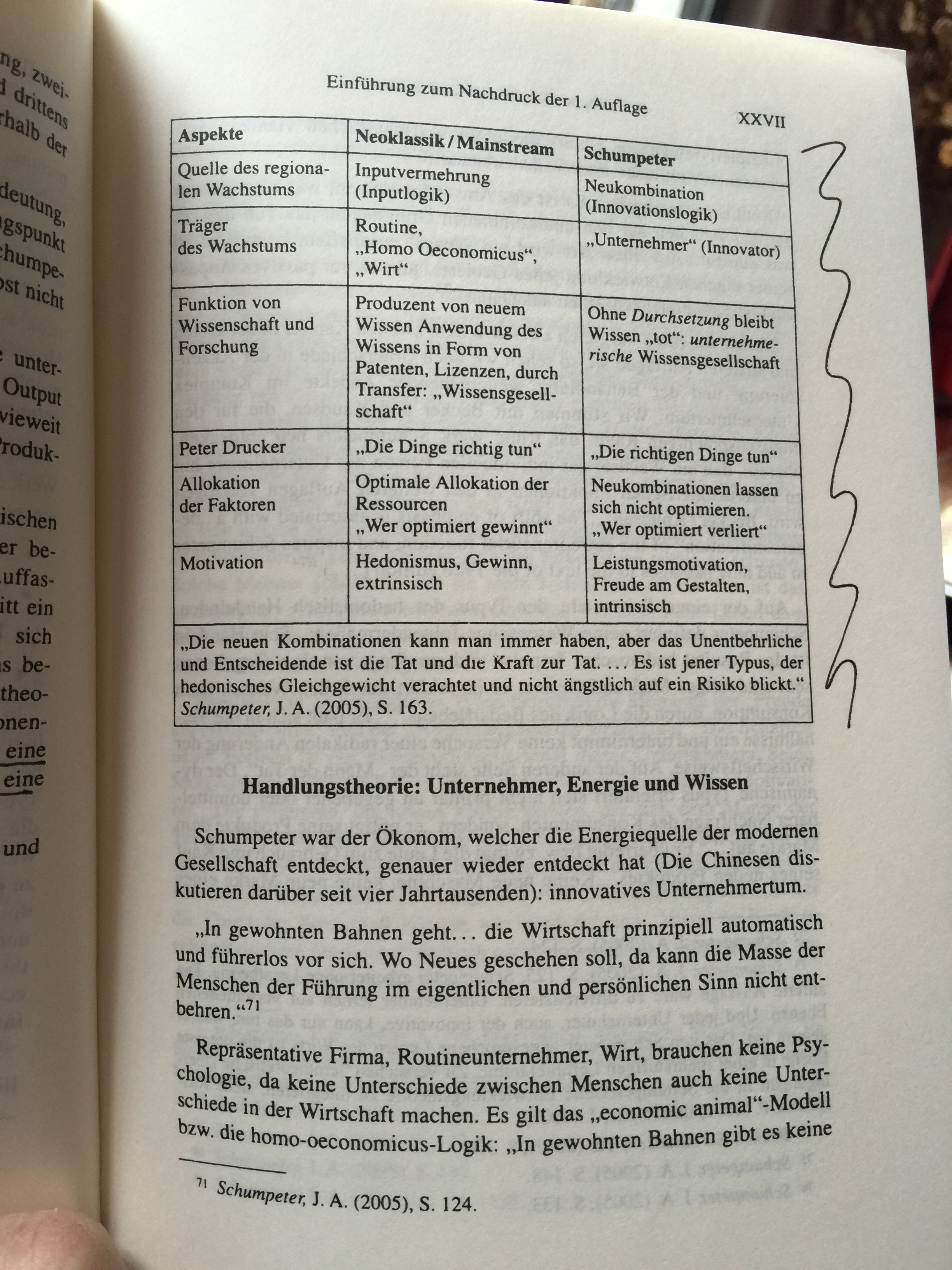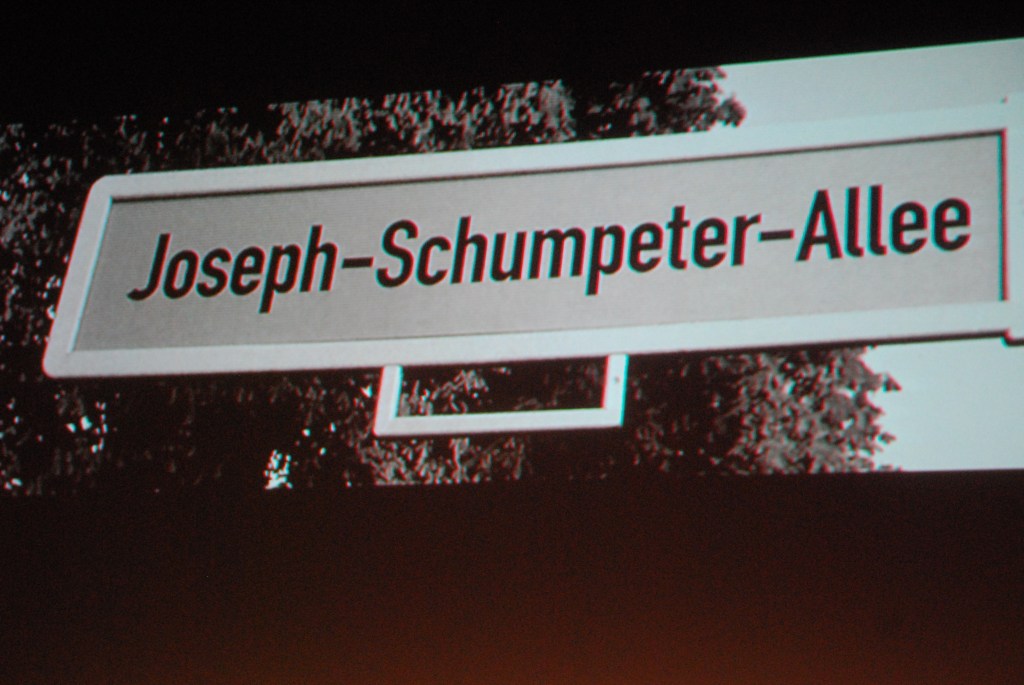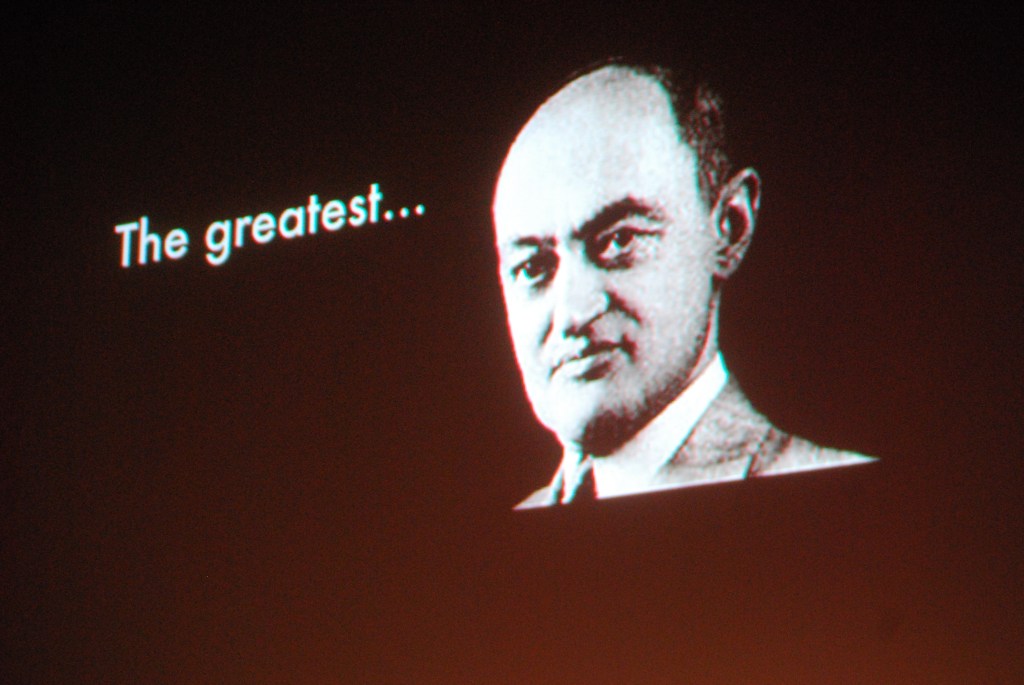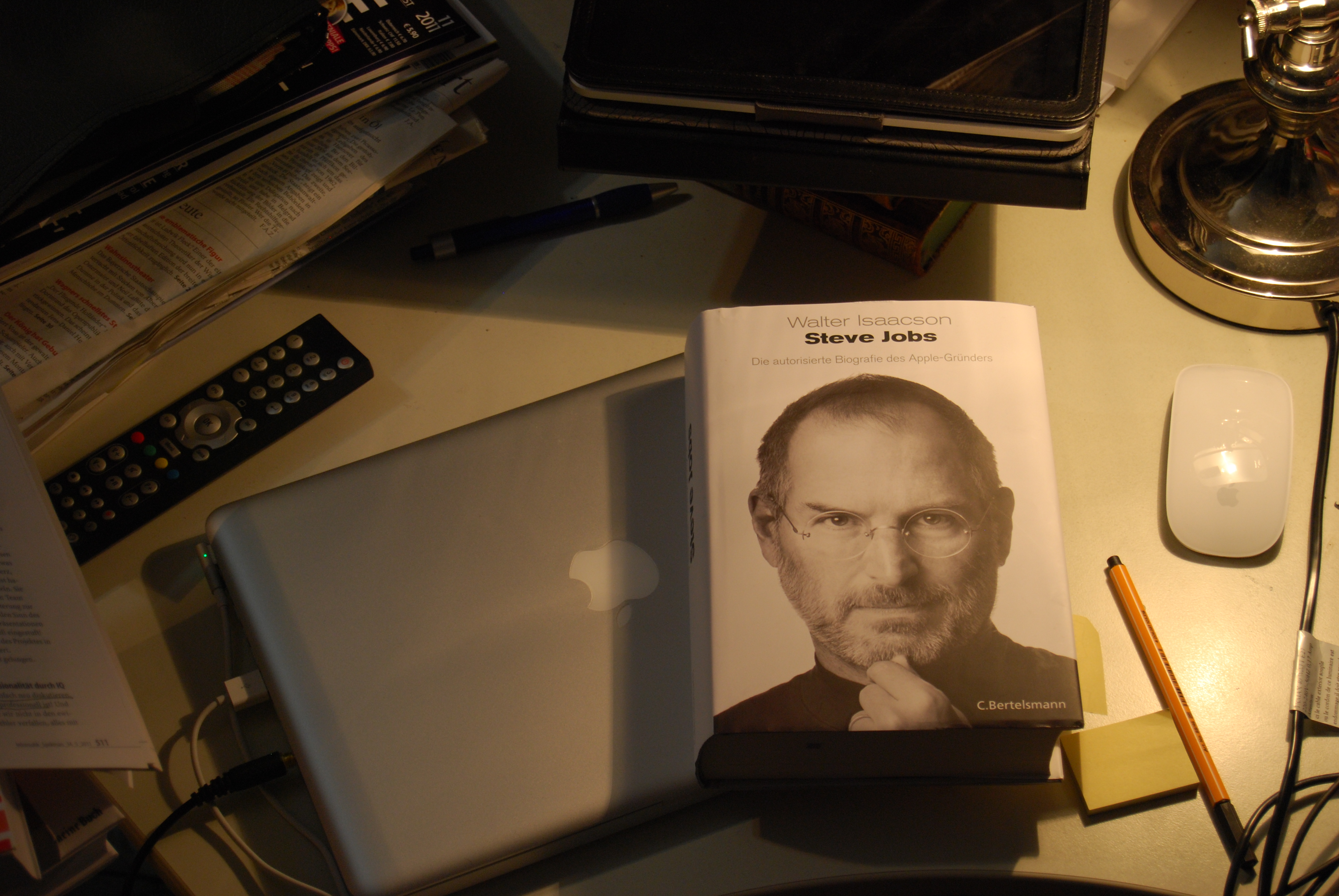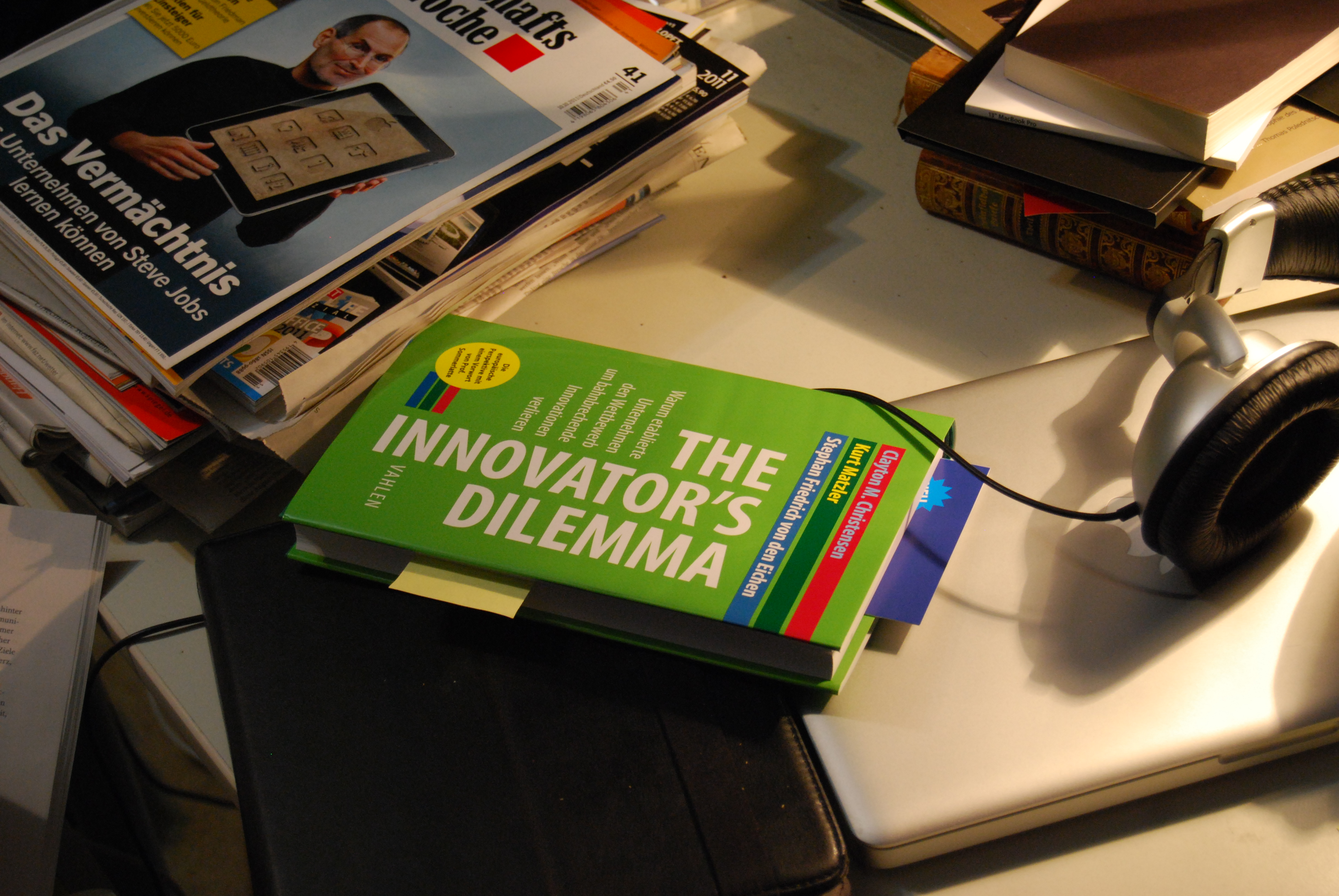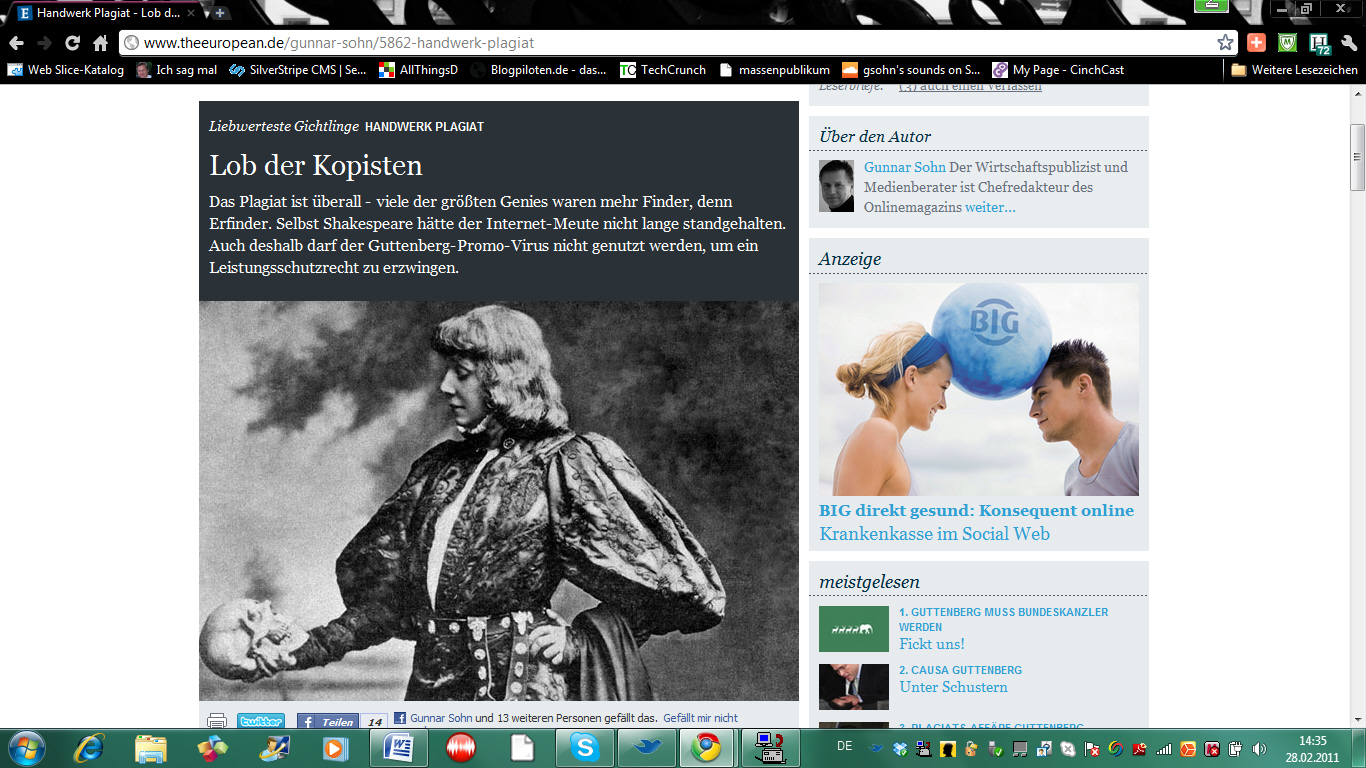Um bei den Digitalthemen in der ersten Liga zu spielen, reicht es für Unternehmen wohl nicht aus, entsprechende Talente oder Startups an Bord zu holen.
„Auch in der Führung muss Kompetenz in Sachen Digitalisierung präsent sein“, fordern Jürgen und Heribert Meffert in ihrem Opus „Eins oder Null“.
Dabei gehe es vor allem um die erste Ebene, die Geschäftsführung und das Aufsichtsgremium, sowie um die zweite Führungsebene.
„Die IT muss als neue Kernkompetenz im Unternehmen verstanden werden, der CDO sollte ein einflussreiches Wort im Führungsgremium mitsprechen – dann klappt es auch mit der Digitalisierung.“
Für die Kulisse passiert gerade eine Menge. Aber ändert sich wirklich etwas in den Führungsetagen?
„Digi-Labs, Innovation-Hubs, Digitalfabriken oder wie immer die deutschen Unternehmen ihre Ableger nennen, sind in den vergangenen Jahren ein fester Teil der deutschen Firmenlandschaft geworden. Ob Daimler, Lufthansa, Thyssenkrupp oder Deutsche Bank – jeder, der zeigen will, dass er die Zukunft anpackt, hat inzwischen ein Labor gegründet. Rund 100 sind es mittlerweile und noch deutlich mehr, wenn man zugekaufte Startups oder IT-Ausgründungen miteinbezieht. Tendenz steigend“, schreibt Capital.
Das Monatsmagazin hat mit der Hamburger Managementberatung Infront Consulting über Monate Dutzende von Laboren besucht. Bislang sind die Ergebnisse ernüchternd: Wirklich Geld habe noch niemand verdient, auch die nicht, die schon länger dabei sind.
„Es fällt auf, dass bisher betriebswirtschaftlich eigentlich fast nichts erreicht wurde“, zitiert Capital Julian Kawohl, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, der die Studie wissenschaftlich begleitet hat. „Kein Unternehmen hat durch sein Lab signifikantes Neugeschäft aufgebaut.“
Was fehlt, sei die Bereitschaft der Konzerne, wirklich im großen Stil Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Noch stünden die Labs unter Welpenschutz, heißt es in der Studie.
Controller und die Sucht nach der kurzfristigen Rendite
Noch sei die Begeisterung bei den CEOs hoch. Noch werden die Units von dem verführerischen Parfüm des Neuen umgeben.
„Das aber könnte sich ändern, wenn die Controller kommen und Nachweise für wirtschaftlichen Erfolg verlangen“, schreibt Capital und hätte vielleicht die systemischen Defizite der Deutschland AG stärker unter die Lupe nehmen sollen.
Viele Konzerne und mittelständische Unternehmen leben von der Substanz. Sie setzen nicht auf neue Technologien, sondern auf höhere Preise und Scheininnovationen.
Wachsende Konzentration in wichtigen Branchen und eigentumsrechtliche Verflechtungen schädigen die Innovationskraft, um Zukunftsthemen wie die Kreislaufwirtschaft, die Mobilitätswende und den Klimaschutz zu stemmen. Wir bescheiden uns lieber mit Dumping-Kapitalismus, mahnt Wolfgang Neef, ehemaliger Vizepräsident der Technischen Universität Berlin. Rendite-Geilheit rückt an die Stelle der Qualitätsproduktion.
Value-Engineering statt Qualitätsproduktion
Die Studenten von Neef berichten, dass in der Firma Siemens professionelle Ingenieurarbeit, die ihre Zeit braucht und nicht mit billigsten Mitteln arbeitet, als „Over-Engineering“ geschmäht werde. Es soll stattdessen um „Value-Engineering“ gehen, also Ingenieurarbeit, die primär den Unternehmenswert an der Börse im Blick hat und möglichst geringe Kosten aufweist.
Laut Handelsblatt ist das national und international kein Einzelfall. Statt Produkte zu erfinden, würden sich Firmen im Zahlenjonglieren üben: Statt Wissenschaftler einzustellen, Forschungslabore einzuweihen oder neue Geschäftsfelder zu gründen, baut man die Finanzabteilung aus, in der dann neue Tricks zur internationalen Steuerarbitrage ausgebrütet werden. Laut einer Studie des MIT setzen die meisten Konzerne nicht mehr auf langfristige Grundlagenforschung und angewandte Forschung, sondern konzentrieren ihre Ausgaben auf kurzfristige Ziele. Ein immer größerer Anteil der Patentanmeldungen dient nicht mehr dem Schutz von Innovationen, sondern soll die Anwendung innovativer Technologien durch Konkurrenten blockieren.
Solche Effizienzdogmatik führt zur Sparsamkeit der Geisteskraft, so der Duktus der aphoristischen Schrift „Kritik der grotesken Vernunft“ aus der Feder von Lars Hochmann:
„Jede Gesellschaft hat die Unternehmen, die sie verdient.“
Das muss aber nicht zur fatalistischen Gegenwartsrestauration führen.
„Zukünfte zu gestalten, bedeutet: die Wirklichkeit aufheben lernen“, so Hochmann, der mit seiner Aussage gut zur Programmatik der D2030 Initiative passt. Denn: „Unternehmen sind von Menschen gemacht und damit immer auch anders machbar.“
Ausführlich in meiner Netzpiloten-Kolumne nachzulesen.
Effizienzdogmatik in der Praxis: Microsoft streicht zehn Prozent der Stellen in Deutschland