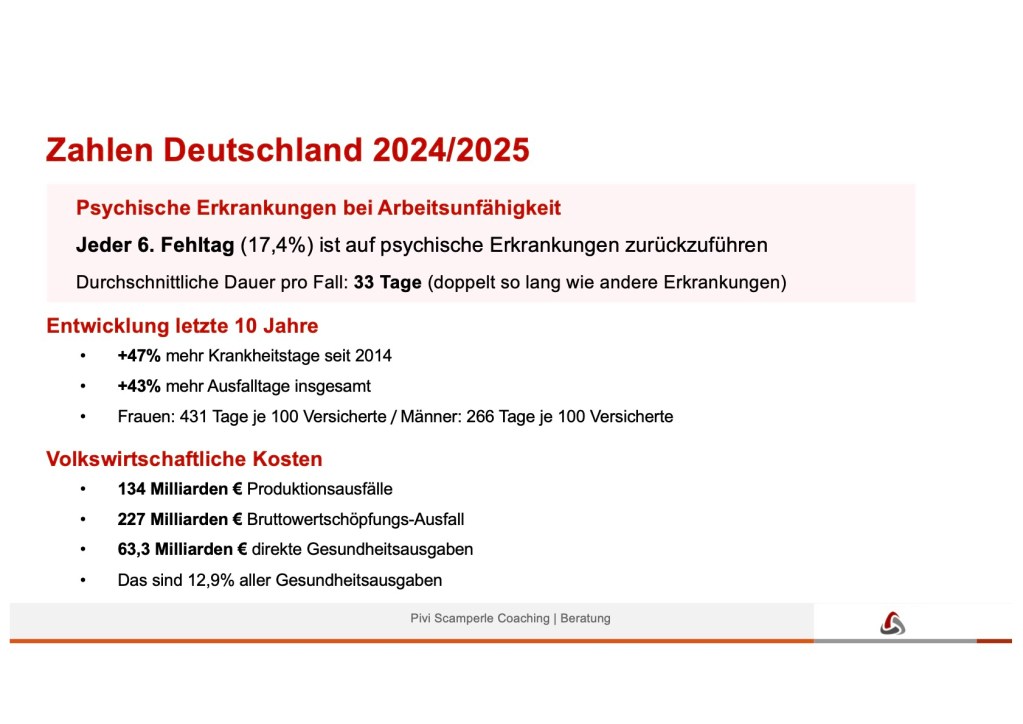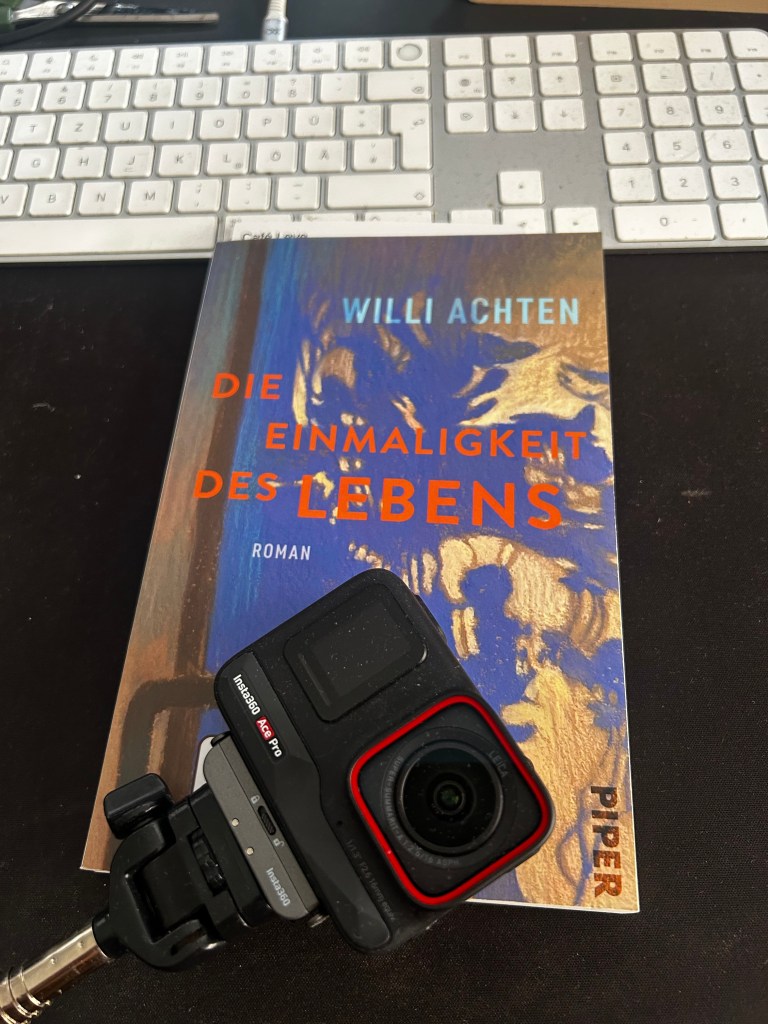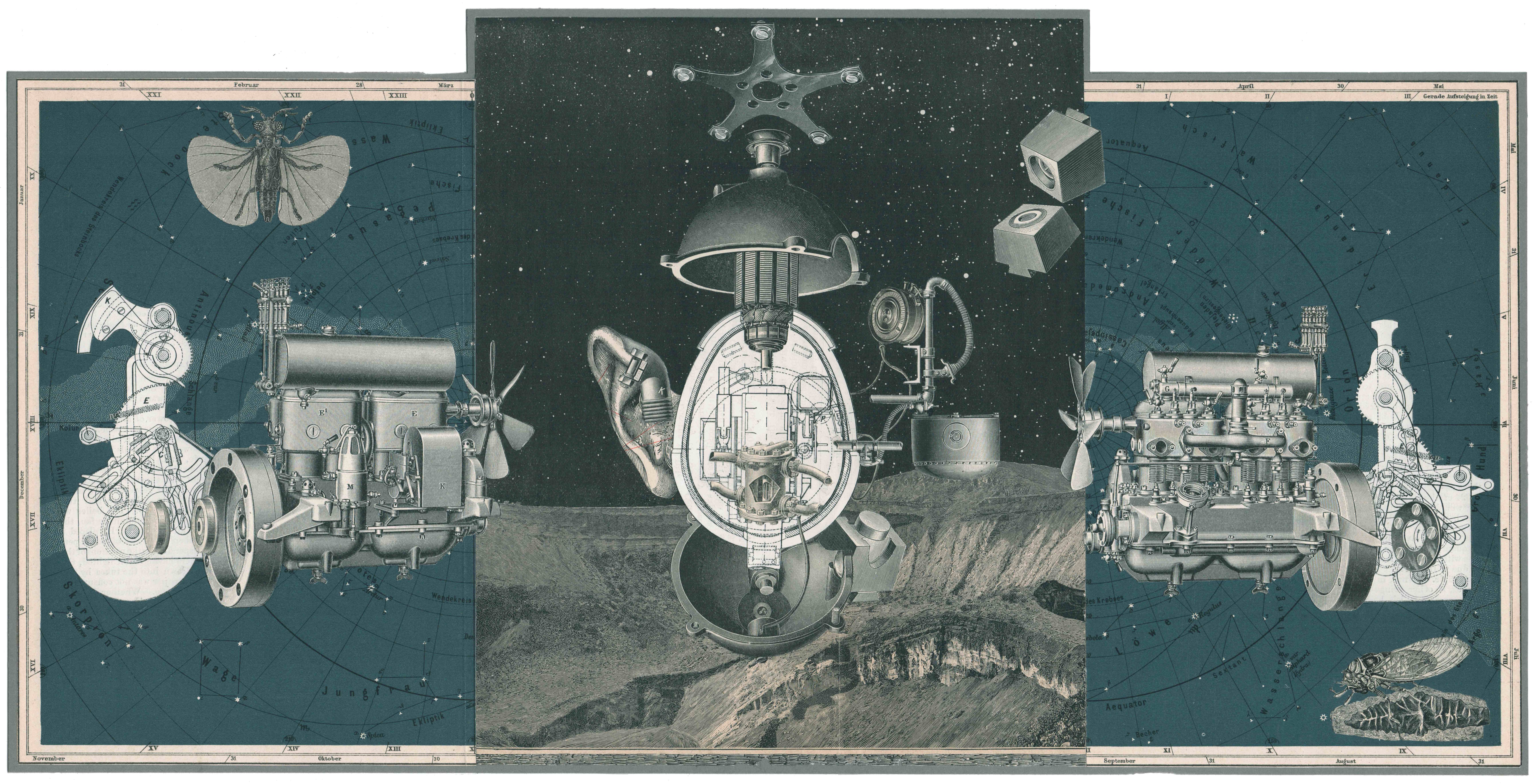Ein Abschied von historischem Format
Mit Jürgen Habermas ist eine Gestalt des deutschen Geisteslebens gegangen, an der sich die Bundesrepublik über Jahrzehnte gemessen hat. Er wurde 96 Jahre alt. Sein Tod markiert mehr als das Ende eines außergewöhnlich langen und produktiven Lebens; er markiert den Abschied von einer Figur, in der sich Theorie und Intervention, Gelehrsamkeit und Zeitkritik, philosophische Strenge und politische Einmischung auf seltene Weise verbanden. Habermas war nie nur Philosoph und Soziologe. Er war Prüfstein, Reizfigur, moralischer Bezugspunkt.
Dass sein Tod als Epochenbruch empfunden wird, hat mit dieser eigentümlichen Doppelstellung zu tun. Kaum ein anderer Denker hat die intellektuelle Physiognomie der alten Bundesrepublik so nachhaltig geprägt und zugleich ihr Selbstbild so beharrlich irritiert. Von den frühen fünfziger Jahren an hat Habermas sich in fast alle großen Kontroversen der Republik eingemischt: in die Auseinandersetzung mit Heidegger, in die Konflikte um die Studentenbewegung, in den Historikerstreit, in die Debatten über Europa, Krieg, Erinnerung, Öffentlichkeit. Er war, in einem präzisen Sinn, kein bloßer Kommentator der Zeit, sondern ihr intervenierender Denker.
Der heideggersche Anfang
Es gehört zu den aufschlussreichen, lange eher verdeckten Zügen dieser Biographie, dass sie nicht in der Helligkeit diskursethischer Vernunft begann, sondern in der Faszination für Martin Heidegger. Der junge Habermas schrieb zunächst in einem Ton, den Philipp Felsch jüngst, bei einer Lesung in Bonn, treffend als „Heidegger-Sound“ beschrieb: jenes Pathos des Vernehmens, der Umkehr, des rechten Verhältnisses zu den Dingen. Man muss sich diesen Anfang vergegenwärtigen, um die spätere Bewegung dieses Denkens zu verstehen.
Denn Habermas wurde nicht als fertiger Demokrat zum Philosophen der Öffentlichkeit. Er hat sich in diese Rolle hinein argumentiert. Der Bruch mit Heidegger war deshalb mehr als eine politische Distanzierung; er war eine geistige Häutung. Als Heidegger seine kompromittierten Vorlesungen aus der NS-Zeit ohne ernsthafte Revision veröffentlichte, widersprach Habermas öffentlich. Von da an war der Weg vorgezeichnet: weg von der beschwörenden Tiefensprache des Seins, hin zu einer Philosophie, die Geltung nur noch im Medium der Begründung anerkennt. Nicht Ursprung, sondern Rechtfertigung. Nicht Sendung, sondern Argument.
In diesem Bruch liegt die eigentliche Signatur seines Werkes. Habermas hat die deutsche Philosophie nach 1945 aus der metaphysischen Düsternis in die Nüchternheit demokratischer Verfahren überführt, ohne sie der Banalität des bloß Funktionalen preiszugeben.
Gegenmodell zu den Franzosen
Für viele der späteren Leser war Habermas zunächst weniger eine Verheißung als ein Widerpart. Philipp Felsch hat diese Erfahrung einer ganzen Generation plastisch beschrieben. Wer in den achtziger und neunziger Jahren von den Franzosen her kam, von Derrida, Foucault, Deleuze, begegnete Habermas oft in Gestalt des Gegners: als staatstragendem Denker, als Vertreter einer strengen, professoralen Vernunft, der gegen die elegante Leichtigkeit und intellektuelle Verspieltheit des Poststrukturalismus wie ein deutscher Verwaltungsbeamter der Theorie wirkte.
Gerade in dieser Abstoßung lag jedoch ein produktives Missverständnis. Denn was damals wie Steifheit erschien, erwies sich rückblickend als eine besondere Form von intellektueller Redlichkeit. Habermas schrieb nicht, um zu verführen. Er schrieb, um Belastbarkeit zu erzeugen. Seine Sätze waren oft schwer, manchmal unerquicklich, fast nie brillant im schimmernden Sinn des Wortes. Aber sie wollten tragen. In einer Kultur, die den Gedanken zunehmend nach seiner Stilfähigkeit beurteilte, hielt Habermas an der Zumutung fest, dass Begriffe Arbeit verlangen dürfen.
Der Philosoph der Verständigung – und des Konflikts
Habermas wurde zum Philosophen der Verständigung. Darin liegt der Kern seines Denkens. Die Sprache, so seine grundlegende Annahme, ist nicht bloß Instrument der Behauptung, sondern auf Verständigung angelegt; wer spricht, erhebt Geltungsansprüche, die sich nicht beliebig machen lassen. Aus dieser Einsicht erwuchs die Theorie des kommunikativen Handelns, und aus ihr speiste sich auch sein normatives Vertrauen in die Lernfähigkeit demokratischer Öffentlichkeiten.
Gleichwohl war Habermas im politischen Raum selten der versöhnliche Moderator, als den seine Theorie ihn erwarten ließe. Im Gegenteil: Er konnte scharf, verletzend, unerbittlich sein. Felsch hat das mit leichter Bosheit auf die Formel gebracht, Habermas sei in seinen Feindschaften „schmittianischer“, als er selbst je zugeben wollte. Das ist nicht ungerecht. Wer seine Polemiken liest, erkennt rasch, dass hier einer kämpfte, identifizierte, zuspitzte, Gegner markierte und Fronten definierte.
Diese Spannung ist keine Nebensache. Sie gehört zum Kern der Figur. Der Denker der Verständigung wusste, dass Verständigung nicht im harmonischen Einverständnis besteht, sondern in der Austragung von Konflikten unter Bedingungen, die Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit nicht preisgeben. Seine Schärfe war oft der Preis seines Anspruchs.
Das Wohnzimmer der Republik
Vielleicht lässt sich diese Figur nirgends anschaulicher fassen als in jenem Bild, das Philipp Felsch von seinem Besuch in Starnberg gezeichnet hat. Der modernistische Bungalow, die helle Schurwollcouch, die abstrakten Bilder, die ruhige Behaglichkeit eines Hauses, das gleichermaßen Weltläufigkeit und Provinz ausstrahlt. Dazu der alte Mann in Chinos und fabrikneuen Reeboks, der Tee zubereitet und sich dafür entschuldigt, dass der Marmorkuchen zu dick geschnitten sei.
Das ist mehr als Anekdote. In diesem Interieur verdichtet sich etwas vom sozialen Stil der alten Bundesrepublik: die Nüchternheit des Wiederaufbaus, das Pathos der Sachlichkeit, die stille Bildungsgewissheit, die Bereitschaft, Weltgeschichte im Wohnzimmer zu verhandeln. Habermas war dieser Republik nicht äußerlich. Er war ihr Ausdruck und ihr Kritiker zugleich. Vielleicht konnte er gerade deshalb so wirksam gegen ihre Selbstzufriedenheit anschreiben: weil er aus demselben Material gemacht war.
Der öffentliche Intellektuelle
Habermas’ Sonderstellung erklärt sich nicht nur aus dem Rang seiner Bücher, sondern aus seiner unablässigen Präsenz im öffentlichen Streit. Der „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ machte früh sichtbar, dass moderne Gesellschaften nicht allein durch Institutionen, sondern durch Kommunikationsformen zusammengehalten oder zersetzt werden. Die „Theorie des kommunikativen Handelns“ versuchte später, diese Einsicht systematisch auszubauen. Doch seine eigentliche historische Bedeutung liegt vielleicht darin, dass er seine Begriffe immer wieder in den rauhen Stoff der Zeit hineintrug.
Im Historikerstreit war diese Rolle am deutlichsten zu sehen. Habermas verteidigte damals mit Entschiedenheit die Einsicht, dass Auschwitz nicht in eine historische Normalität eingeebnet werden dürfe. Er machte die deutsche Vergangenheit zum Prüfstein republikanischer Vernunft. Man kann mit guten Gründen sagen, dass er damit nicht bloß eine Debatte gewann, sondern der Bundesrepublik für eine ganze Phase ihr moralisches Vokabular lieferte. Von da an ließ sich über Nation, Erinnerung und politische Identität nicht mehr sprechen, ohne sich zu ihm zu verhalten.
Europa als Horizont der Vernunft
In seinen späteren Jahrzehnten rückte Europa ins Zentrum seines Denkens. Für Habermas war die europäische Einigung nie nur ein institutionelles Arrangement. Sie war die politische Form, in der die universalistischen Lernprozesse der Nachkriegszeit bewahrt werden konnten. Europa bedeutete ihm die Chance, nationale Selbstbehauptung in eine postnationale Rechts- und Bürgergemeinschaft zu überführen. Nicht Machtbalance, sondern Zivilisierung war der Maßstab.
Gerade darum gewannen seine späten Texte einen zunehmend melancholischen Ton. Das europäische Projekt erschien ihm mehr und mehr als unvollendet, technokratisch verengt, politisch mutlos. Der alte Habermas blickte mit wachsender Skepsis auf die Erosion demokratischer Institutionen, auf das Wiedererstarken nationalistischer Reflexe, auf die Schwäche eines Kontinents, der zwar ökonomische Größe, aber immer weniger politische Form besaß. In seinen letzten Interventionen sprach ein Denker, der an der Vernunft festhielt, ohne sich über die Beschädigungen der Wirklichkeit hinwegzutäuschen.
Die Melancholie nach Habermas
Was mit Habermas nun fehlt, ist nicht bloß ein großer Name. Es fehlt eine Form von Ernsthaftigkeit, die in der deutschen Öffentlichkeit selten geworden ist. Habermas war nie bequem. Den einen war er zu moralisierend, den anderen zu akademisch, den Dritten zu links, den Vierten zu westlich, den Fünften zu universalistisch. Aber gerade in dieser Zumutung lag seine Größe. Er verlangte, dass man Gründe gibt. Er verlangte, dass Geschichte nicht verdrängt, sondern durchgearbeitet wird. Er verlangte, dass Demokratie mehr ist als das Management wechselnder Stimmungen.
Vielleicht wird man ihn künftig weniger als Architekten eines Systems lesen denn als Repräsentanten einer intellektuellen Haltung, die sich dem Zeitgeist nicht auslieferte. Seine Sätze werden nicht leichter werden. Manche seiner Gewissheiten werden weiter bestritten werden. Aber sein Rang liegt tiefer. Er hat gezeigt, dass Philosophie in einer Demokratie mehr sein kann als gelehrte Selbstbespiegelung: ein Eingriff, eine Verpflichtung, eine Form öffentlicher Verantwortung.
In Starnberg ist nun einer gestorben, der die Deutschen über Jahrzehnte dazu anhielt, vernünftiger zu sein, als sie es im Zweifel sein wollten. Darin liegt das eigentlich Melancholische dieses Abschieds. Nicht nur ein Leben ist an sein Ende gekommen. Ein Maßstab ist verschwunden.