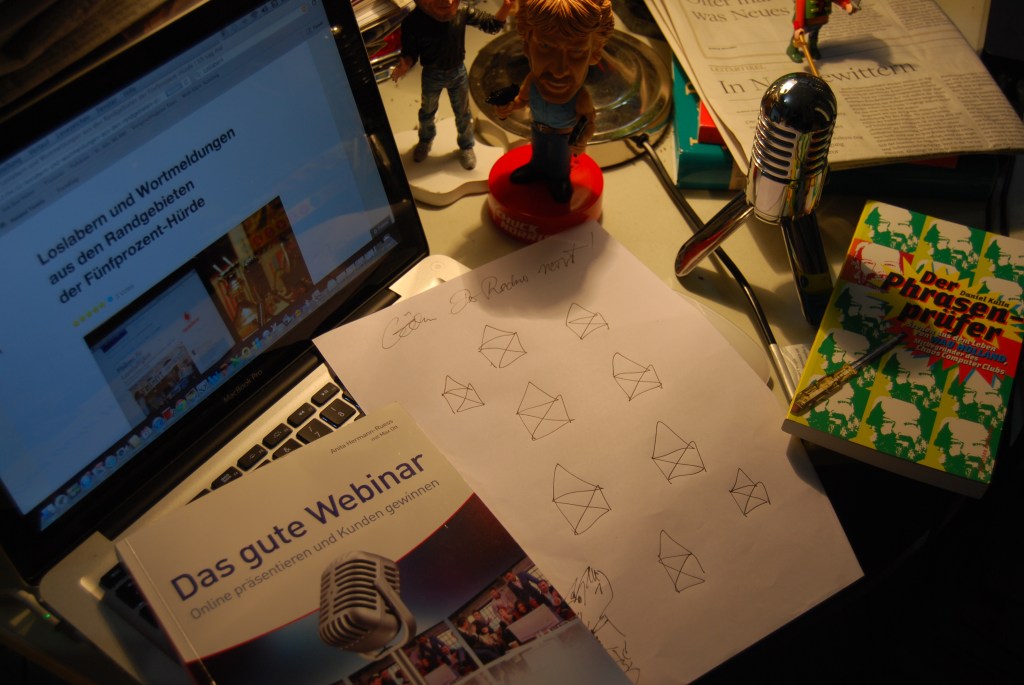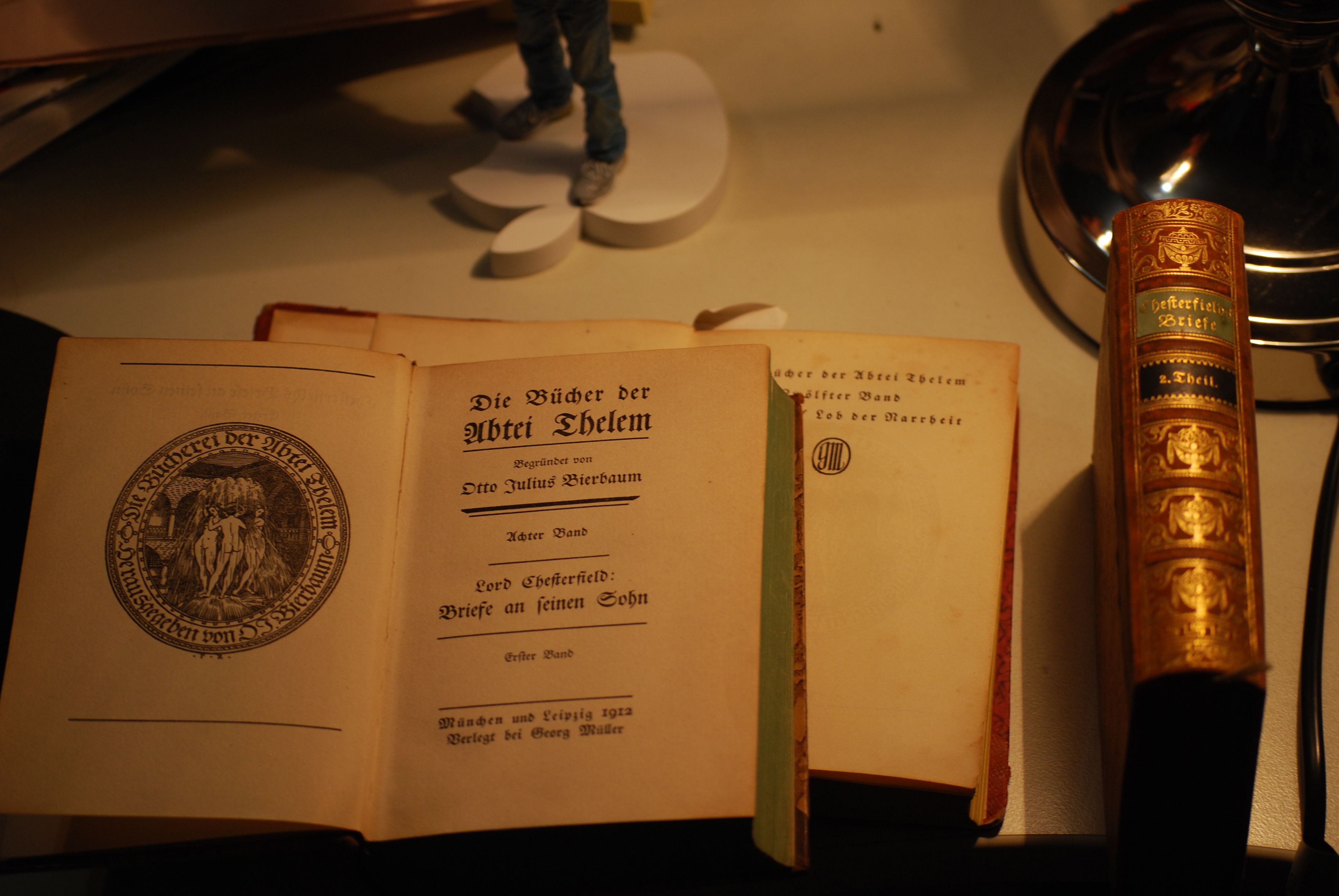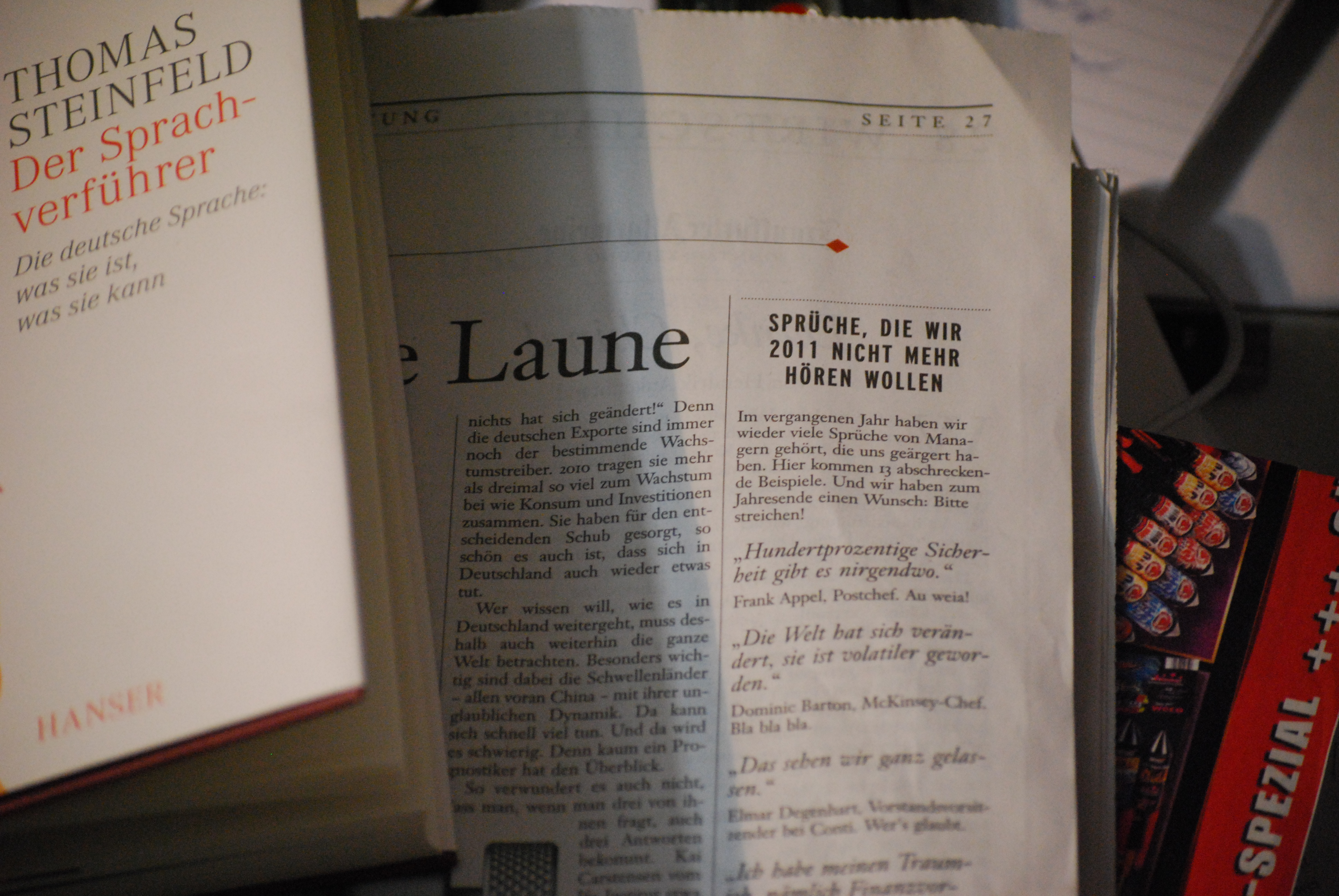Blecherne Stimmen, verkrampfte Moderation, kaum Interaktion und Referenten, die mit einer Flut von propagandistischen Powerpoint-Folien im sonoren Ton loblabern und wehrlose Zuschauer in den Netzschlaf wiegen: Man nennt das Ganze auch Heizdecken verkaufen über so genannte Webinare. Um uns aus der Flut von belanglosen Online-Präsentationen zu erretten, kommt der Band „Das gute Webinar“ (erschienen im Addision-Wesley-Verlag) von Rhetorik-Expertin Anita Hermann-Ruess und dem Visualisierungs-Spezialisten Max Ott gerade richtig. Ich habe das Werk heute in meiner Kolumne für Service Insiders besprochen. Hier geht es zur Rezension.
Selbstgefällige Redner, die sich als stotternde Vorleser von übel gestalteten Textfolien mit phrasenhaften Bullet-Points darstellen, nerven schon bei normalen Präsenzveranstaltungen. Virtuell wirken sie besser als jedes handelsübliche Schlafmittel. Wenn man das Gehirn dieser Zuhörer nun mit dem Computertomografen analysieren könnte, leuchtet nicht das Belohnungssystem auf, sondern die Neigung zur Bestrafung.
Im Auditorium eines Kongresses unterhält man sich dann mit seinem Nachbarn, studiert die neuesten Nachrichten auf dem iPad, rennt aufs Klo, genehmigt sich einen Kaffee im Foyer oder übersät seine Tagungsunterlagen mit „Das-ist-das-Haus-vom-Nikolaus“-Zeichnungen. Was anderes bekomme ich gar nicht hin – im Kunstunterricht war ich immer eine Niete.
Da bei einem Webinar die negativen Reaktionen nicht sichtbar sind, „könnten sich die gelangweilten Teilnehmer durch das Ausbleiben von sozialen Kontrollmechanismen getrost einer Parallel-Beschäftigung widmen, E-Mails checken oder an ihrem Dokument weiterarbeiten. Das ist leider die Realität schlecht gemachter Online-Präsentationen“, führen die beiden Webinar-Kenner aus. Was bei einem normalen Kongress schon tödlich sein kann, beschleunigt sich bei Webinaren wie in einem Katalysator. Als Redner bekomme ich virtuell kaum eine Chance, das Ruder herumzureißen und mit einem Witz oder einer Anekdote das Publikum wieder für mich zu gewinnen.
Wenn Referenten dann noch mit monotoner und einschläfernder Stimme aufwarten, ihre Denkpausen mit „Ähs“ und „Ahms“ überspielen, Silben verschlucken und ständig ins Mikrofon bellen, wirkt das Gesagte wie eine Foltermethode für die Ohren. Aber selbst wenn die Charts grafisch begeistern, die Sprache wirkungsvoll eingesetzt wird und die Stimme nicht die Ohren verunreinigt, schwächeln viele Webinar-Anbieter an der Didaktik und Online-Methodik, wenn es um Interaktionen geht. Man sollte daher auch technologisch auf der Höhe sein, um Dialoge zu ermöglichen. Auf was dabei zu achten ist, steht in dem Service Insiders-Beitrag. Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Würde mich interessieren.
Und wenn selbst der Ratgeber „Das gute Webinar“ keine Besserung bringt, hilft nur noch eins: Chuck Norris vor das Mikrofon setzen! Versteht sich von selbst.