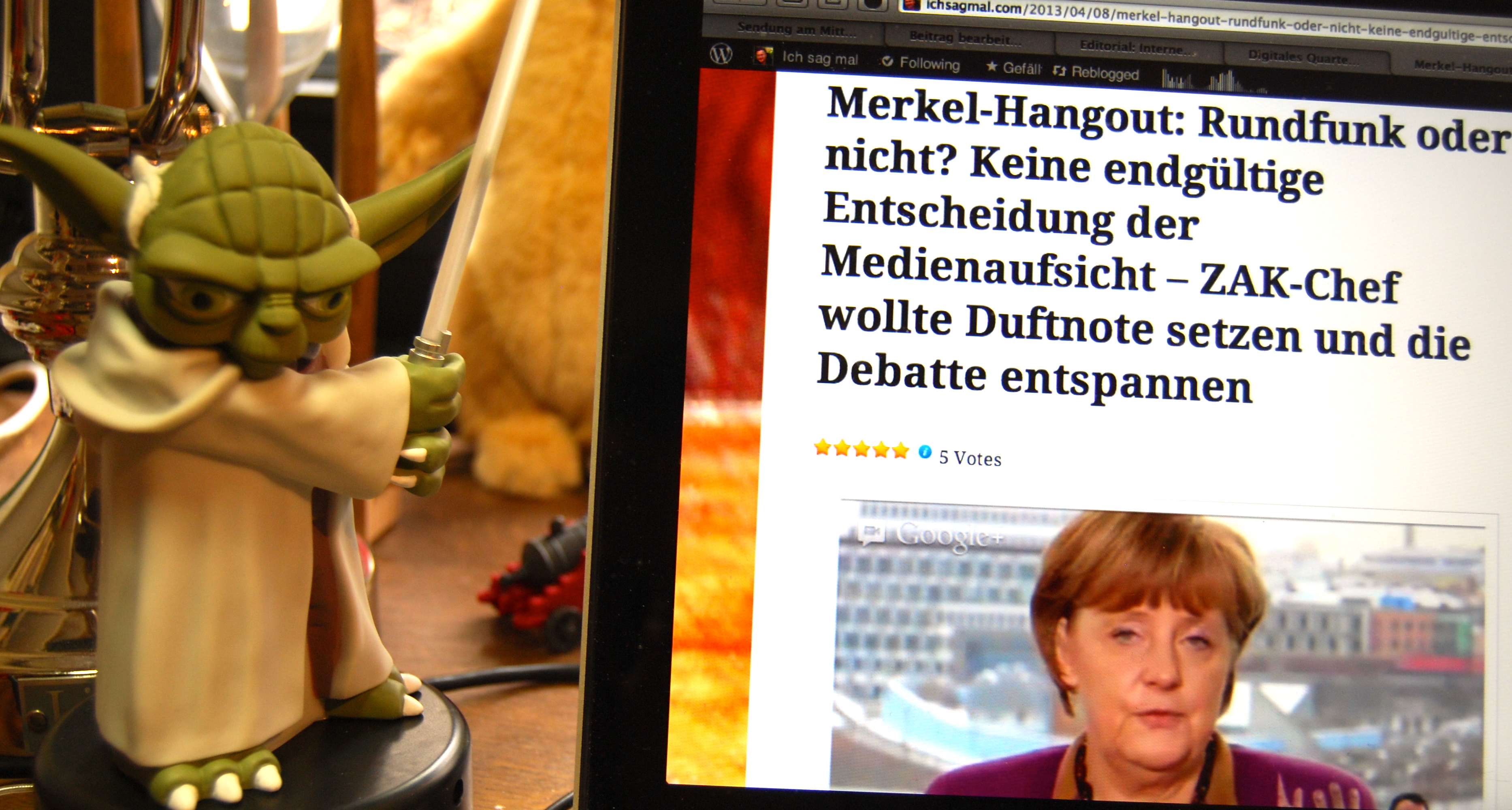In den USA sieht der ehemalige The European-Herausgeber Alexander Görlach in den neuen Medien-Marken wie Mic, Vice oder Buzzfeed gute Karrierechancen für Journalisten.
„In Deutschland ist mein Eindruck, dass eher eingespart werden soll als ausgegeben.“
Die Strukturen werden nach Einschätzung von Görlach ausgedünnt.
„In den USA gibt es noch einige Akteure, die an die Zukunft von Journalismus glauben und die viel Geld investieren. In Deutschland gibt es keine entsprechende Begeisterung und Investitionen in diesem Maße.“
Vielleicht liegt es ja an der Überalterung der Medienunternehmer. Sie leben von der Substanz, investieren kaum und verdrängen die Notwendigkeit von Erweiterungsinvestionen sowie Innovationen. Ein Trend, der nach Studien der KfW für viele Wirtschaftsbranchen gilt: 57 Prozent der Unternehmen mit Chefs unter 40 Jahren investieren. Mit steigendem Unternehmeralter sinkt der Investorenanteil deutlich. Bei den über 60-jährigen Unternehmensinhabern erreicht er nur noch 37 Prozent. Auch die Art der Investition verändert sich mit steigendem Alter. Stärker risikobehaftete und kapitalbindende Vorhaben werden seltener, die noch durchgeführten Investitionen dienen in erster Linie der Pflege des Kapitalstocks. Jürgen Stäudtner spricht in seinem Innovationsstau-Buch gar von einer Hedgefonds-Mentalität, die bei den arrivierten Firmenchefs dominiert.
Eigentümerfamilien der Verlage haben kräftig Umsatzrendite gescheffelt
Im Mediensektor gehen jedenfalls nur wenig Impulse für innovative Themen aus – etwa beim Roboterjournalismus, in der Daten-Analyse oder beim Einsatz von Chatbots. Das skizzierte Saim Alkan von AX Semantics auf dem Besser Online-Kongress des Deutschen Journalisten Verbandes (DJV) in Köln:
„Die großen Medienhäuser liegen in den Händen einiger Eigentümerfamilien. Die haben über Jahre rund 20 bis 25 Prozent Umsatzrendite gescheffelt. Hocken auf hunderten Millionen Euro Kapital. Wenn es darum geht, 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, um ein agiles Projekt zu starten, dann wendest Du Dich an Deinen Vorgesetzten, an Deinen Verleger oder Chefredakteur und der sagt dann, das müssten wir selbst erwirtschaften, weil die Verlegerfamilie nichts zurück investiert.“
Wer soll also neue Projekte bezahlen?
„Fangen wir doch mal an, die Leute, die seit 30 oder 40 Jahren Gelder aus den Häusern gezogen haben, zu bitten, wieder zu reinvestieren“, fordert Alkan.
Die Verlegerfamilien sollten wieder etwas zurückgeben und mehr Experimente wagen.
„Die erste Digitalisierungswelle wurde ausgesessen. Vielleicht sollte man bei der zweiten Welle etwas tun und dazu gehört eben auch Geld.“
Konkurrenz bekommen die etablieren Medien zunehmend von branchenfremden Unternehmen, die beim Content Marketing und bei Broadcasting-Einheiten im Verbund mit Big Data-Programmen und Künstlicher Intelligenz kräftig zulegen. Könnten Daimler, Telekom und Co. die Verlage überholen? Dieser Zug sei schon längst abgefahren, so Alkan.
Unternehmen und Sportverbände als Nachrichtenproduzenten
Es gebe sogar erste Sportverbände, die ihre Nachrichten selbst produzieren, weil sie in der Presse zu wenig vorkommen.
„Die erteilen Journalisten sogar schon Haus- oder Platzverbote, um die Exklusivität ihres Contents zu bewahren. Dazu kommen Content Marketer, die mit einem riesigen Druck Service-Themen aufarbeiten. Beispielsweise über die Qualität von Badeseen in Deutschland. Da gibt es Anbieter, die diese Informationen aus öffentlicher Hand nehmen und in einfache Lückentexte einbauen. Wenn ich dann Informationen über die Wasserqualität des nächstgelegenen Badesees suche, poppt nicht mehr meine Tageszeitung auf, die das Thema gar nicht aufgreift, weil es zu teuer und zu schwierig ist, sondern irgend ein Content Marketer, der mit einer Automatisierung nützliche Informationen vermittelt und dadurch Werbeeinnahmen über Google generiert“, erläutert Alkan in Köln.
Unternehmerjournalismus oder Werbung?
Da entstehe eine Befähigung selbst für kleine Unternehmen oder Verbände, Content in großen Mengen zu produzieren. Das führe zu einer Veränderung im Rollenverhältnis zu Journalisten, die dann für solche Berichte nicht mehr notwendig sind. Ob das Ganze zu einem Verfall des Journalismus führt, wurde in einem zweiten Panel heftig unter dem Titel „Rettungsanker oder Sargnagel? Content Marketing“: Professor Lutz Frühbrodt von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Würzburg hält es für problematisch, dass man gar von Unternehmensjournalismus spricht. Diese Zuordnung sei falsch. Es sei letztlich nur eine Ersatzform von Werbung. Entsprechend wichtig seien auf der operativen Ebene Kennzeichnungspflichten.
„Das andere Thema ist, welche Auswirkungen Content Marketing auf die öffentliche Kommunikation und die öffentliche Meinungsbildung hat.“
Er sieht Content Marketing als weiteren Sargnagel des Journalismus. Diesen Befund thematisierte ich bereits in der April-Ausgabe des prmagazins. Sascha Pallenberg von Daimler hält diese Sorge für unbegründet: Sie sei eher ein Beleg für zu wenig Selbstbewusstsein auf der journalistischen Seite. Die Herausforderung liege bei den klassischen Medien, Premiuminhalte herauszubringen.
„Gute Unternehmenskommunikation lebt von der Transparenz. Es muss klar sein, von wem die Botschaften stammen.“
So sieht es auch Karsten Lohmeyer von der Agentur „The Digitale“, einer hundertprozentigen Tochter der Deutschen Telekom:
„Ein großer Teil des täglich produzierten Medienbreis besteht aus belanglosem Entertainment, zusammengestrichenen Pressemitteilungen, schlecht recherchiertem Nutzwert und leider viel zu oft aus armselig versteckter Schleichwerbung. Die so genannten Native Ads auf den Online-Seiten der Verlage sind viel problematischer. Die werblichen Inhalte sind von den redaktionellen Beiträgen kaum zu unterscheiden.“
Man müsse sich dem neuen Wettbewerb im Digitalen stellen.
„Was die Content-Produzenten auf der Unternehmensseite killen, ist in erster Linie schlechter Journalismus.“
Lohmeyer trat bei der Kölner DJV-Veranstaltung als Antipode von Frühbrodt auf.
„Ich arbeite mit journalistischem Werkzeug. Der Journalist ist mein Konkurrent. Ich bin der Konkurrent des Journalismus. In manchen Dingen sind wir symbiotisch, aber im Markt der medialen Kommunikation stehen wir im Wettbewerb. Manchmal gewinnt der Bessere und manchmal gewinnt auch der, der mehr Geld hat.“
Häufig werde auf der Seite des Content Marketings gar kein so außergewöhnlicher Job gemacht. Häufig sei es eher so, dass von den klassischen Journalisten ein viel zu schlechter Job geleistet werde.
„Die interessieren sich nicht für Suchmaschinen-Optimierung, die interessieren sich nicht für Reichweitenaufbau. Die interessieren sich natürlich für die gute Geschichte. Aber nicht dafür, wie sie die gute Geschichte an die Menschen bringen. Und plötzlich erreichen wir im Monat 500.000 Leute und die Fachmagazine nur 10.000“, sagt Lohmeyer und erwähnt als Positivbeispiel die von seiner Agentur realisierte Sportnews-Plattform ISPO.com.
Hier werden Technologien und Fähigkeiten eingesetzt, die der Journalismus auch nutzen könnte.
„Er tut es aber nicht oder er tut es viel zu selten“, so Lohmeyer.
Phantomdiskussion unter Journalisten
Ob das nun als Journalismus gewertet werde oder nicht, sei eher eine Phantomdiskussion, die unter Journalisten geführt wird. Dem Rezipienten sei das egal. Es handelt sich um Content.
„Der User macht das Smartphone an oder schlägt das Laptop auf und trifft auf Inhalte“, erklärt Lohmeyer.
Ob sie nun von Bots, Journalisten oder Marketers erstellt werden, sei dabei zweitrangig. Jeder kann Sender und Empfänger von medialen Botschaften sein. So ist das nun mal im Netz. Ob das nun als Journalismus auf der akademischen Seite gewertet wird oder nicht, ist eher nebensächlich. Ob man nun Blogger als Journalisten anerkennt oder nicht, stört nicht den Erfolg von Blogprojekten.
Interviews zum Thema:
Fortsetzung folgt.
Ein weiteres Problem beschreibt Marcel Weiss: Bei all ihrem Gejammer über die Distributionsmacht von Facebook und Google: Die deutschen Medien sind so unselbständig, dass erst ein Mittelsmann kommen muss, der die Distribution kontrolliert, damit sie ansatzweise zukunftsträchtige1 neue Formate machen.