Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer und Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hatten im vergangenen Jahr ihre Strategie zur Klima- und Energiepolitik im Biokraftstoffsektor der Öffentlichkeit vorgestellt und sie als wichtigen Beitrag zur Klima- und Energiepolitik sowie zur Entwicklung der ländlichen Räume gepriesen.
Biokraftstoffe, so das damalige Credo von Gabriel, können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten – allerdings nur, wenn sie signifikant zur Kohlendioxid-Reduktion beitragen. „Das stellen wir gesetzlich sicher. Und außerdem sorgen wir dafür, dass importierte Biomasse zukünftig nur dann eingesetzt werden darf, wenn sie nachhaltig angebaut worden ist. Es kann nicht sein, dass anderswo auf der Welt Wälder gerodet und Moore trockengelegt werden, um Palmöl anzubauen, das dann bei uns als vermeintlich klimafreundlicher Rohstoff eingesetzt wird“, sagte Gabriel bei der Vorstellung der so genannten „Roadmap Biokraftstoffe“.
Allerdings warnten Experten schon vor Monaten davor, bei Biokraftstoffen zu ehrgeizige Ziele zu formulieren und dabei eine Antwort schuldig zu bleiben, woher die nachwachsenden Rohstoffe kommen sollen. „Nicht nur die technologische Verträglichkeit von Biosprit ist ein Schwachpunkt. In Deutschland fehlen die nötigen Anbauflächen. Von Importen sind wir auf jeden Fall abhängig. Zudem ist es höchst fragwürdig, weltweit eine künstliche Verknappung von Getreide in Kauf zu nehmen, die zu einer drastischen Verteuerung von Lebensmitteln führt. Schon jetzt ist der Preisdruck für die Verbraucher spürbar“, kritisiert Uwe Röhrig, Inhaber des Automobilberatungshauses International Car Concept (ICC) und ehemaliger Vertriebschef für Mercedes-Benz und Maybach.
Gabriel und Seehofer sollten endlich aufhören, der Öffentlichkeit unter dem Banner des Klimaschutzes knallharte Wirtschaftsinteressen der Öko- und Agrarlobby unterzujubeln. Für das Biosprit-Debakel seien beide verantwortlich. „Biosprit, Bionahrung oder Bioplastik – das Ganze ist ökologischer Etikettenschwindel. Wenn wir den heimischen Agrarsektor auf biologischen Anbau umstellen würden, müsste in Deutschland die Ackerfläche um sechs Millionen Hektar erweitert werden. Die ist aber nicht vorhanden, also wird kräftig aus Südamerika importiert. Ähnlich hoch wäre der Flächenbedarf, wenn wir aus eigener Kraft Agrotreibstoffe herstellen wollten. Bei Bioplastik ist die Entsorgung ungeklärt, also muss das Zeug verbrannt werden. Der ökologische Anspruch und die Wirklichkeit klaffen bei fast allen nachwachsenden Rohstoffen weit auseinander. Die Bezeichnung ‚Bio‘ ist eher ein ein Qualitätssiegel für Volksverdummung“, moniert Röhrig. Ein internationales Wissenschaftlerteam um den niederländischen Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen hat sogar nachgewiesen, dass die alternativen Kraftstoffe klimaschädlicher als Benzin sind. „Biosprit-Pflanzen“ – in Deutschland vor allem Mais und Raps – müssen stark gedünkt werden. Dadurch gelangt das gefährliche Stickoxid (N2O) in die Atmosphäre. Ein Teil dieses Treibhausgases wird durch chemische Reaktionen in Lachgas umgewandelt – ein über 300 mal stärker wirkendes Treibhausgas als Kohlendioxid. Crutzen und sein Team haben nachgewiesen, dass bei der Produktion von Biosprit fast doppelt so viel Stickoxid in die Atmosphäre gelangt, wie Wissenschaftler des UN-Klimarats IPCC bislang angenommen hatten. Im Vergleich zu normalem Benzin oder Diesel ist Raps-Benzin 1,7 mal klimaschädlicher und aus Mais hergestelltes Ethanol 1,5 mal. Selbst Ethanol aus Zuckerrohr kommt auf einen Faktor von 0,5. Auch wenn es die Agrarlobby nicht gerne hört, die kritischen Stimmen zu nachwachsenden Rohstoffen werden immer lauter. Das gilt auch für so genannte Biopolymerwerkstoffe, die auf Basis von Zucker, Stärke, Cellulose oder Pflanzenölen hergestellt werden. Die Ökobilanz fällt noch verheerender aus, wenn tropische Regenwälder gerodet werden, um Anbauflächen für Zuckerrohr zu gewinnen. Ähnlich negativ ist die ökologische Wirkung, wenn Palmöl aus Indonesien um den halben Globus verschifft werden muss, um es hier zu verarbeiten. 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen sind auf die Rodung von Wäldern zurückzuführen. Nach Berechnungen der Weltbank sei allein Indonesien durch das permanente Abholzen seiner Wälder mittlerweile zum drittgrößten Treibhausgasproduzenten geworden.
Ähnlich sieht es der Münchner Publizist Miersch Miersch. Die Vorsilben „Öko“ und „Bio“ werden zur Zeit an alles Mögliche geklebt, ohne dass jemand nachfragt, ob die so geadelten Produkte oder Verfahren tatsächlich einen Umweltvorteil bieten. Nicht überall, wo „grün“ drauf steht, ist auch „grün“ drin. Was in der Bevölkerung als ökologisch gilt, habe meist mehr mit geschickter Imagepolitik von Interessengruppen zu tun als mit Fakten. „Bio ist prima fürs Klima!“ werben Ökoagrarverbände und fordern einen „Klimabonus“ für ihre Betriebe. Ihr Argument: Wir sparen Mineraldünger, zu dessen Herstellung fossile Brennstoffe verbraucht werden. Konventionelle Bauern kontern: „Mehr Milch pro Kuh ist aktiver Klimaschutz!“ Ihr Argument: Konventionelle Höfe erzeugen mehr Milch, Fleisch und Eier pro Tier. Auch erreichen die Tiere ihr Schlachtgewicht viel früher, leben also kürzer und brauchen weniger Futter. Ergo: Sie stoßen weniger klimaschädliches Methan aus.„Bei näherer Betrachtung erweisen sich viele angeblich grüne Lösungen als Mogelpackungen, die manchmal sogar mehr schaden als nützen“, so der Einwand von Miersch. Zweifelhaft ist beispielsweise der Versuch der französischen Regierung, per Dekret die Ausgabe nicht biologisch abbaubarer Kunststoff-Tragetaschen an den Kassen von Supermärkten zu verbieten. „In Wirklichkeit geht es um französische Agrarinteressen und um die Abschottung französischer Märkte“, kritisiert der Frankfurter Wissenschaftsjournalist Edgar Gärtner. Der Entwurf des französischen Dekrets beziehe sich lediglich auf einen bestimmten Typ von Plastiktüten, deren Gesamtmenge von jährlich 85.000 Tonnen gerade einmal 0,3 Prozent der französischen Haushaltsabfälle ausmacht. Würde zu deren Produktion jedoch Kartoffelstärke eingesetzt, könnte der Absatz von Stärkekartoffeln in Frankreich um 50 Prozent gesteigert werden. „Das zeigt, dass die französische Regierung mit ihrem Dekretentwurf nicht Abfallprobleme, sondern die Agrarförderung im Auge hatte“, so der Einwand von Gärtner.
PlasticsEurope, die Vertretung der europäischen Kunststoffhersteller, hat im Oktober 2006 und noch einmal im Mai 2007 in einem Schreiben an die EU-Generaldirektion Unternehmen und Industrie formell gegen den französischen Vorstoß Beschwerde eingelegt. Selbst die französische Umwelt- und Energieeffizienzbehörde ADEME warnte in der Auswertung einer 2004 für die Supermarktkette „Carrefour“ erstellten vergleichenden Produkt-Lebensweg-Analyse davor, den Einsatz biologisch abbaubarer Kunststoffe für Tragetaschen als per se umweltschonend hinzustellen. Wissenschaftlich unseriös ist nach Meinung von Umweltexperten auch die Behauptung, dass durch die Verwendung von biologisch-abbaubaren Verpackungen (BAW) kein Treibhauseffekt entstehe, da nachwachsende Rohstoffe durch Sonnenlicht aus Wasser und Kohlendioxid ständig neu gebildet werden: „Das gilt vielleicht für reines Pflanzenmaterial, aber nicht für Verkaufsverpackungen. Die industrielle Landwirtschaft, die Verpackungsherstellung und die angestrebte Kompostierung belasten die Umwelt. In der gesamten Produktionskette entstehen Kohlendioxid-Emissionen“, so der Einwand eines Vertreters der Entsorgungswirtschaft.
„Bioplastik-Herstellung verursacht umweltschädliche Emissionen“ – Interview mit dem Verpackungsexperten Christian Pladerer vom Österreichischen Ökologie-Institut in Wien
Frage: Hersteller und Interessenvertreter von Bioplastik behaupten, dass durch die Verwendung von biologisch-abbaubaren Verpackungen (BAW) kein Treibhauseffekt entstehe und diese Produkte CO2-neutral seien, da nachwachsende Rohstoffe durch Sonnenlicht aus Wasser und Kohlendioxid ständig neu gebildet werden. Was halten Sie von dieser Einschätzung?
Christian Pladerer: Ich halte wenig von dieser Einschätzung. Um die tatsächliche Umweltbelastung einer Verpackung festzustellen, müssen alle relevanten Umweltauswirkungen entlang des gesamten Lebensweges vom Abbau der Rohstoffe, inklusive Hilfsstoffe und Energieträger, über die Transportwege bis hin zur Entsorgung betrachtet werden. Es dürfen also nicht nur einzelne Emissionen wie CO2 für einzelne Abschnitte des Lebensweges berechnet werden. Es stimmt schon, dass Pflanzen im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen durch Sonnenlicht aus Wasser und Kohlendioxid ständig neu gebildet werden. Ob das auch für Einwegverpackungsmaterial gilt, ist sehr fraglich: Die rohstoff- und energieintensive industrielle Agrarwirtschaft und Verpackungsherstellung sowie die von den BAW Herstellern empfohlene Kompostierung sind Aktivitäten, die umweltschädliche Emissionen verursachen. Aus meiner Sicht sind somit BAW-Verpackungen keinesfalls CO2-neutral.
Frage: In Ihrer Studie schreiben Sie, dass selbst die Kompostierung der PLA-Becher keinen nennenswerten ökologischen Nutzen bringen würde. Die Auswirkungen der Entsorgung seien nur marginal im Vergleich zur Herstellung der Becher. Die Möglichkeit der Kompostierung wird aber von den Herstellern immer wieder in den Vordergrund gestellt. Wie beurteilen Sie die Entsorgungsmöglichkeiten der PLA-Becher unter den verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten (Verbrennung, Biogas, Kompost) und welche Umwelteffekte hat das auf die gesamte Ökobilanz der PLA-Becher?
Pladerer: Die privaten und kommunalen Kompostwerke in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz, die Kompost mit hoher Qualität herstellen, sind wenig begeistert von der Diskussion über ‚kompostierbare’ Kunststoffe. Hier muss zwischen biologisch abbaubar und kompostierbar unterschieden werden. Organische Materialien wie Küchenabfälle, Strauchschnitt oder Papier sind biologisch abbaubar. Durch natürliche Prozesse und durch Mikroorganismen sind diese Materialien in ihre Bausteine zerlegbar. Kompostierung ist eine technisch gesteuerte exotherme biologische Umwandlung abbaubarer organischer Materialien in ein huminstoffreiches organisches Material. Ziel der Kompostierung ist der möglichst rasche und verlustarme Abbau der organischen Ursprungssubstanzen und gleichzeitig der Aufbau stabiler, pflanzenverträglicher Humussubstanzen. Dass ein Werkstoff biologisch abbaubar ist, bedeutet noch lange nicht, dass diese Umwandlung in einem Rotte- oder Mieteprozess der technischen Kompostierung tatsächlich im gewünschten Ausmaß erfolgt. Im Unterschied zu ‚biologisch abbaubar’ wird für ‚kompostierbar’ ein Zeitrahmen vorgegeben. Es fehlt nun an der Glaubwürdigkeit, dass biologisch abbaubare Kunststoffe auch kompostierfähig sind. Zusätzlich werden BAW-Verpackungen wie herkömmliche Kunststoffverpackungen von automatischen und mechanischen Sortierschritten erkannt und als Fremdstoff aussortiert. Das gilt nicht nur für die Kompostierung sondern auch für Biogasanlagen. Schließlich bleibt die Müllverbrennungsanlage als einzige derzeit praktikable Entsorgungsschiene übrig. Die Ergebnisse unserer Ökobilanz von verschiedenen Getränkebechern zeigen deutlich, dass die Rohstoffbereitstellung und die Becherherstellung beim PLA Becher (biologisch abbaubarer Einwegkunststoffbecher) rund 95 Prozent der gesamten Umweltbelastung ausmachen.
Frage: Ist die Kompostierung von Bioplastik überhaupt sinnvoll? Was sagen die Kompostbetreiber?
Pladerer: Von den Kompostwerken wird die Annahme von biologisch abbaubaren Kunststoffen zur Zeit nicht akzeptiert. Sie haben eine längere Verweilzeit und einen zu hohen Störstoffanteil.
Frage: Was halten Sie von der vom Bundestag und der Bundesregierung beschlossenen Novelle der Verpackungsverordnung, biologisch-abbaubare Verpackungen von Verwertungspflichten freizustellen? Welche Wirkung wird das auf die Verpackungsindustrie haben?
Pladerer: Die Novellierung der deutschen Verpackungsverordnung ist aus ökologischer Sicht nicht nachvollziehbar und es gibt für den Gesetzgeber keine Rechtfertigung, biologisch abbaubare Verpackungen von den Entsorgungspflichten und damit von den Kosten zu befreien. Wie oben angeführt, landen biologisch abbaubare Kunststoffe in den Öfen der Müllverbrennungsanlagen – und diese brennen auch nicht ‚gratis’. Aus meiner Sicht ist die Reaktion der Verpackungsindustrie natürlich verständlich, da unterschiedliche Entsorgungskosten auch zu Wettbewerbsverzerrungen führen können. Ökologische Lenkungsmaßnahmen über Entsorgungskosten sind prinzipiell zu begrüßen.
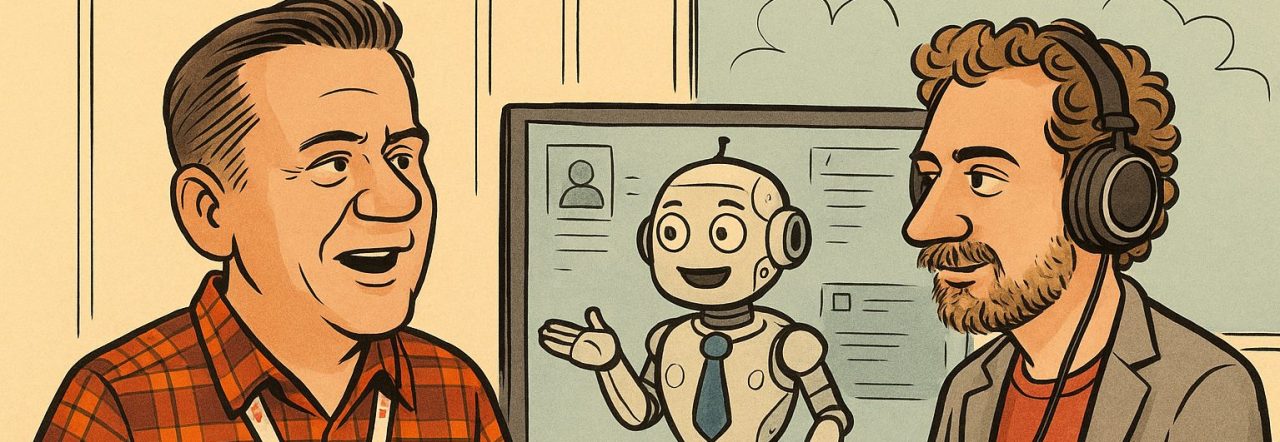


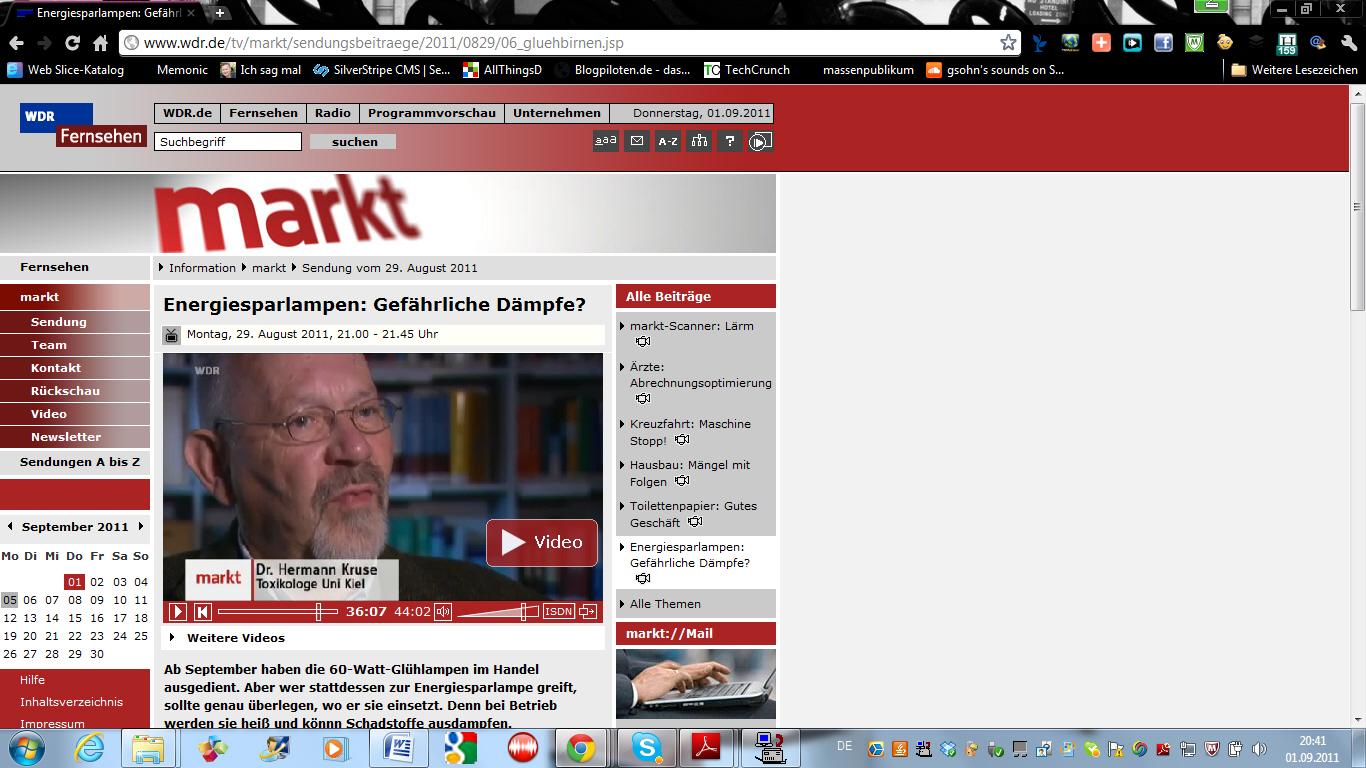


 Erleben wir mit Desertec einen einen der größten Fakes des Jahrhunderts?
Erleben wir mit Desertec einen einen der größten Fakes des Jahrhunderts?