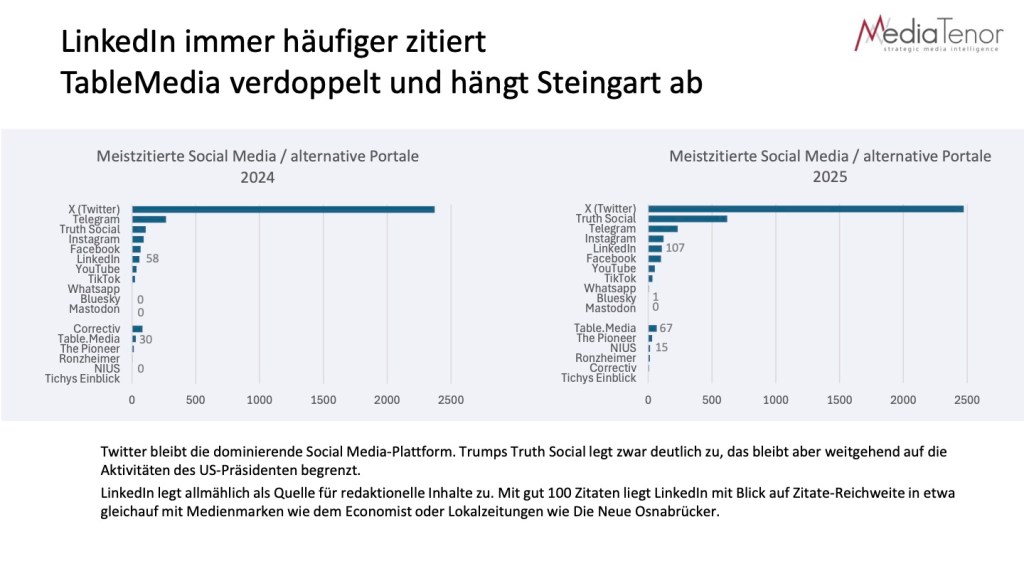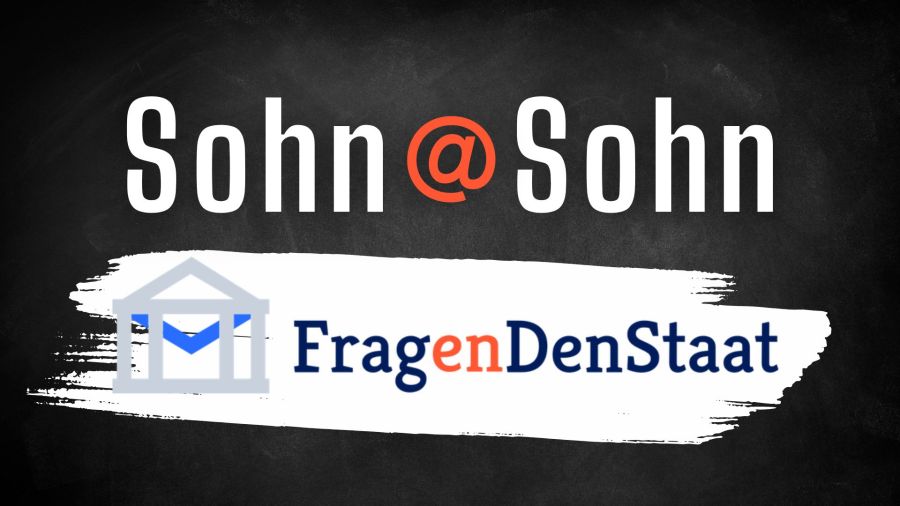Es gibt Indizes, die tun so, als seien sie Thermometer. In Wahrheit sind sie eher Wetterkarten: Sie zeigen nicht nur Temperatur, sondern Windrichtung, Luftdruck, Gewitterneigung – kurz, das Klima einer Lage. Wer Konjunktur verstehen will, muss deshalb lernen, zwischen den Zahlen zu lesen: Nicht jede Zahl ist ein Faktum, manche sind eine verdichtete Erwartung. Und Erwartungen sind in der Wirtschaft kein Beiwerk, sondern ein Antrieb.
Der Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige ist so ein Instrument. Er misst nicht die „große“ Industrie, nicht die exportierenden Flaggschiffe, sondern jene kleinteilige Ökonomie, in der die Entscheidungen häufig unmittelbarer sind: Soloselbständige, Kleinstunternehmen, weniger als neun Beschäftigte – stark dienstleistungsgeprägt, nah am Kunden, nah an der Liquidität. Seit August 2021 wird dieses Segment gesondert erfasst.
Die jüngsten Werte sind unerquicklich klar: Mehr als ein Drittel (35,3 %) erwartet 2026 eine Verschlechterung der eigenen wirtschaftlichen Lage; nur 14 % rechnen mit besseren Geschäften als 2025; 50,7 % erwarten Stillstand. In der Gesamtwirtschaft ist der Pessimismus geringer: 26,1 % erwarten schlechtere, 14,9 % bessere Geschäfte.
Der Satz der ifo-Expertin Katrin Demmelhuber bringt das Ergebnis auf eine Formel: „Die Selbständigen starten mit mehr Sorge als Zuversicht in das neue Jahr.“
Sorge hat eine Struktur
Sorge ist nicht einfach „schlechte Laune“. Sie hat eine Struktur, und diese Struktur ist in den Daten sichtbar. Der Index sank im Dezember auf −23,7 Punkte, nach −19,8 im November: ein Rückschritt zum Jahresende 2025, getragen von schlechteren Lageurteilen und schlechteren Erwartungen.
Noch bedeutsamer als der Stimmungswert ist jedoch ein Begleitsymptom: Ungewissheit. 34,3 % der Selbständigen fiel es schwer, die eigene Geschäftsentwicklung vorherzusagen; im November waren es 32 %. In der Gesamtwirtschaft lag der Anteil im Dezember bei 23,8 %.
Hier zeigt sich ein Kernproblem unserer Zeit: Nicht nur, dass viele Erwartungen negativ sind – sie sind auch unsicher. Wo Unsicherheit steigt, sinkt die Bereitschaft, Risiken einzugehen. In der kleinteiligen Wirtschaft bedeutet das ganz konkret: weniger Investitionen, weniger Einstellungen, mehr Aufschub.
Und dieser Aufschub bekommt, wie so oft, ein finanzielles Gesicht: 47,6 % der Selbständigen melden Schwierigkeiten beim Kreditzugang (Q4, nach 45,1 % in Q3). Gleichzeitig führen nur 10,9 % überhaupt Kreditverhandlungen – gegenüber 26,3 % in der Gesamtwirtschaft. Das ist die stille Klemme: Wer kaum verhandelt, ist entweder zu klein, zu vorsichtig – oder zu entmutigt, um den Versuch zu machen.
Die Parallele zur Allensbach-Frage
An dieser Stelle wird der Anschluss an Ihre Allensbach-Analyse sichtbar. Dort wird seit 1949 zum Jahreswechsel gefragt: „Sehen Sie dem neuen Jahr mit Hoffnungen oder Befürchtungen entgegen?“ – eine einfache Frage, die in ihrer Schlichtheit mehr über Handlungsbereitschaft verrät als mancher Modelllauf.
Ihre jüngste Auswertung beschreibt für 2026 ein Land im Zwischenlicht: 33 % Hoffnungen, 29 % Befürchtungen, 29 % Skepsis, 9 % unentschieden. Das Entscheidende ist dabei weniger die reine Befürchtung als der gleich große Block der Skepsis: nicht Angst, sondern zähes Zögern.
Genau dieses Zögern erscheint nun im Mikrokosmos der Selbständigen in zugespitzter Form. Die Selbständigen sind – stärker als die Durchschnittsbevölkerung – in einer Lage, in der „Hoffnung“ sofort zur Entscheidung werden muss: einen Auftrag annehmen, einen Vertrag verlängern, eine Software anschaffen, einen Kredit aufnehmen, eine zusätzliche Kraft bezahlen. Wenn hier das Klima kippt, kippt es praktisch: nicht in Kommentaren, sondern in Kassenständen.
So fügen sich zwei Messungen zusammen: Das Allensbach-Barometer zeigt das Meinungsklima der Gesellschaft, der Jimdo-ifo-Index das Entscheidungsklima eines besonders konjunktursensiblen Sektors. Und beide deuten in die gleiche Richtung: 2026 beginnt mit Vorsicht – und mit einer Skepsis, die weniger laut ist als wirksam.
Vorlauf statt Nachlauf
Die Lesart des Statistikers Karl Steinbuch – zuerst Optimismus, dann Wachstum – bekommt hier eine zweite Bestätigung: Wenn Stimmung Vorlauf ist, dann sind die Selbständigen ein besonders empfindlicher Sensor. Denn sie sind näher an Unsicherheit und Finanzierung, und sie erleben Regulierung nicht als Debatte, sondern als Formular.
Millionen kleiner Entscheidungen erzeugen erst jene Durchschlagskraft, die wir Aufschwung nennen oder auch nicht. Der Jimdo-ifo-Befund ist in diesem Sinn kein Randthema, sondern ein Frühwarnsignal: Wo ein Drittel Verschlechterung erwartet und nur jeder Siebte Verbesserung, entsteht kein Gleichschritt nach vorn.
Das Problem der öffentlichen Wahrnehmung
Es kommt etwas hinzu, das man in Konjunkturberichten selten liest: die Frage, wer seine Lage überhaupt noch öffentlich artikuliert. In einer Gesellschaft, in der viele Selbständige das Gefühl haben, politisch nicht vorzukommen, wird aus Unmut leicht Rückzug. Dann wird nicht mehr gestritten, sondern abgewinkt; nicht mehr investiert, sondern „erst mal abgewartet“. Gerade diese stille Resignation ist wirtschaftlich gefährlich, weil sie statistisch als „Stabilität“ erscheinen kann – in Wahrheit aber das Absterben von Dynamik bedeutet.
Der Jimdo-ifo-Befund enthält dafür eine harte Kennzahl: der sprunghaft hohe Anteil derjenigen, die ihre eigene Entwicklung kaum noch prognostizieren können. Wo die Zukunft nicht mehr in Szenarien, sondern nur noch in Befürchtungen vorkommt, wird die Gegenwart defensiv.
Politik: Nicht „Start-ups“, sondern Alltag
Wenn eine Regierung (gleich welcher Couleur) Wachstum will, muss sie dort ansetzen, wo Wachstum im Alltag entsteht: bei den Bedingungen, unter denen Menschen überhaupt den Mut haben, selbständig zu arbeiten. Die Realität sieht anders aus: Krankenversicherungsbeiträge, die sich für Selbständige wie eine Strafsteuer anfühlen; eine Rentenarchitektur, die als Zwang und Misstrauen erlebt wird; eine Praxis der Scheinselbständigkeitsprüfung, die aus berechtigter Missbrauchsbekämpfung oft eine Kultur der Verunsicherung macht.
Wenn die politische Erzählung von „Aktivrente“ und „Steuererleichterungen“ handelt, die Realität der Selbständigen aber aus Beitragsbescheiden, Prüfungen und Kreditklemmen besteht, dann entsteht ein Bruch im Meinungsklima: Man fühlt sich nicht gemeint. Und wer sich nicht gemeint fühlt, verhält sich nicht expansiv.
Der einfache Schluss
Man kann die Lage in einem Satz zusammenfassen: Die Skepsis der Bevölkerung findet bei den Selbständigen ihre praktische Übersetzung. Dort, wo aus Stimmung Handlung werden müsste, überwiegt die defensive Erwartung – und die Unsicherheit ist höher als im Unternehmensdurchschnitt.
Herr Bundeskanzler, machen Sie endliche ihre wirtschaftspolitischen Hausaufgaben.