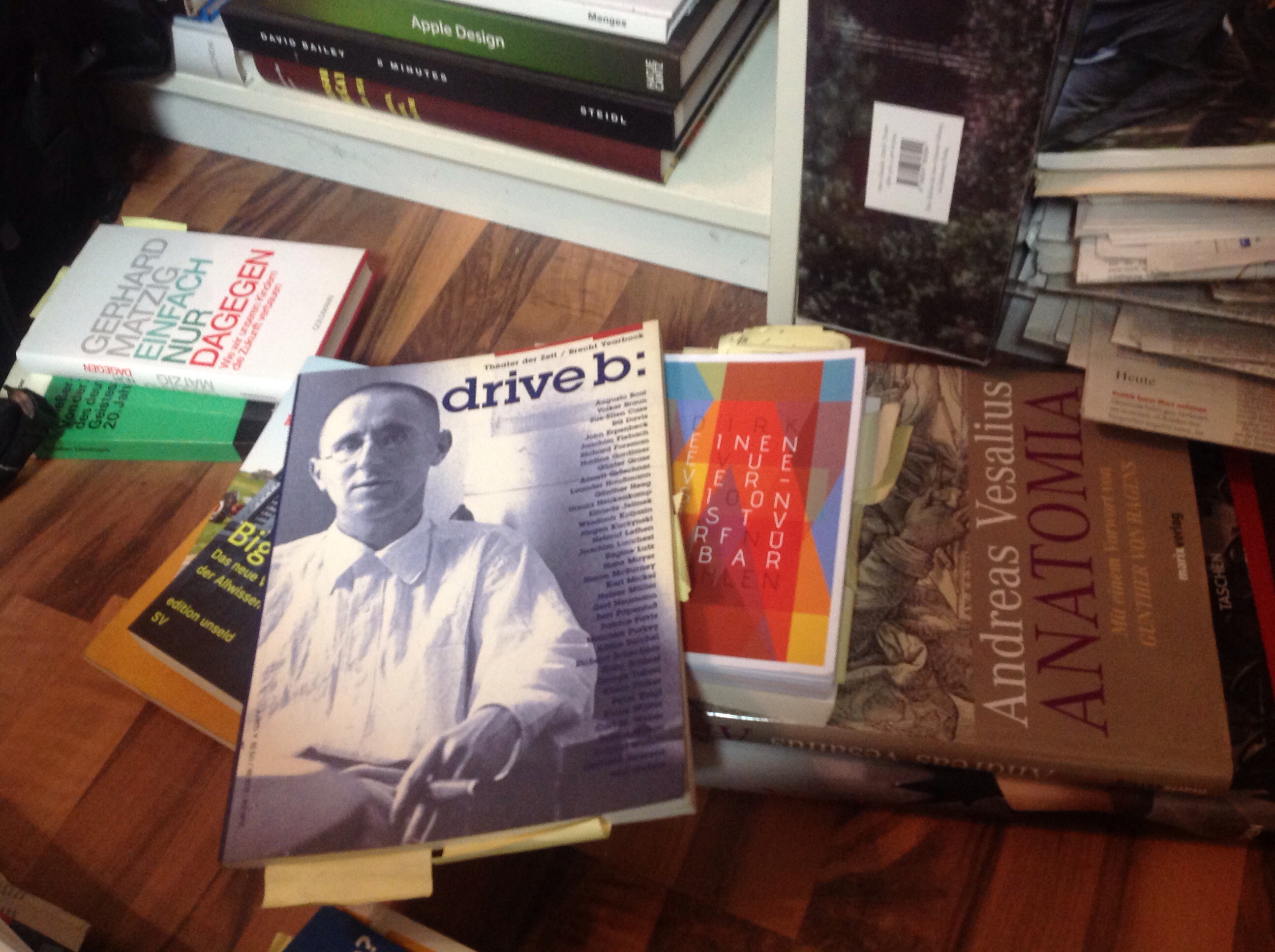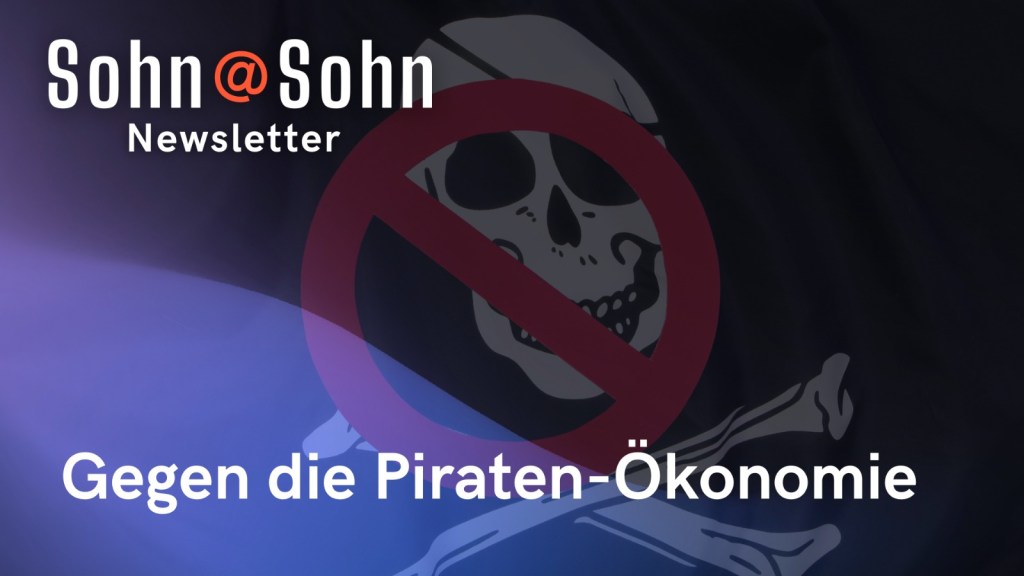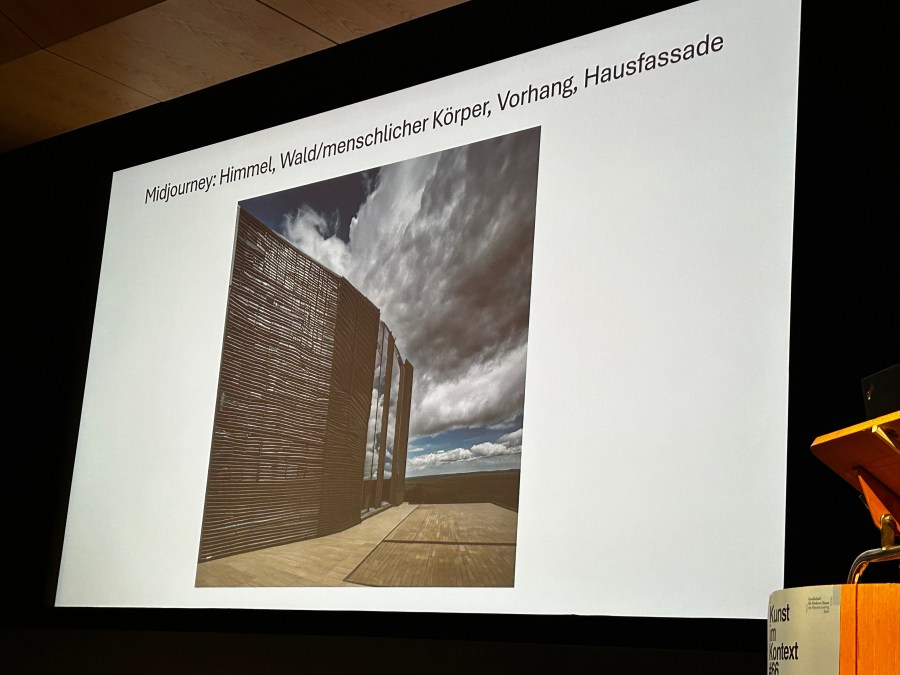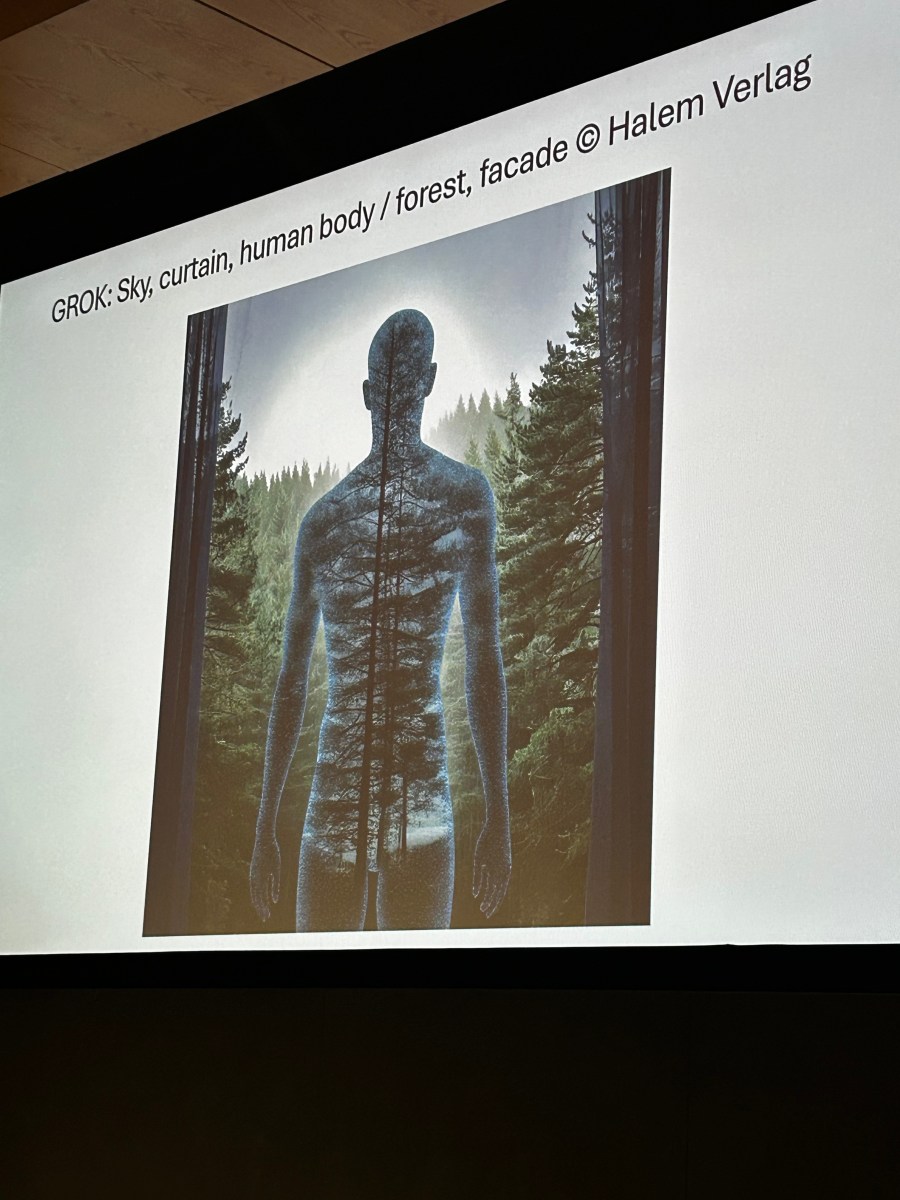Oliver Coste reist, als hätte er eine Deadline mit der Geschichte. Nicht die übliche Konferenzrunde, nicht das gepflegte Panel mit Namensschild, sondern Termin an Termin in den Funktionsgebäuden der Republik: Wissenschaftler, Denkfabriken, Ministerialbeamte, Journalisten. Wer ihn trifft, beschreibt weniger einen Lobbyisten als einen Überzeugungstäter. Coste hat eine Mission – und sie ist so schlicht, dass sie in einer überkomplexen Lage fast wie Erlösung wirkt: Europa brauche nur eine kleine Gesetzesänderung, dann komme der Kontinent wieder in Gang.
Seine These klingt nach Betriebswirtschaft, die sich in nationale Konten übersetzt: Das Scheitern sei in Europa zu teuer, weil Restrukturierungen zu lange dauern und Trennungen zu kostspielig sind. Also investierten Unternehmen vorsichtiger, probierten weniger aus, hielten länger an Pfaden fest, die nicht tragen. Wer dagegen, so Coste, den Kündigungsschutz für die oberen Einkommensgruppen lockere – in der Debatte ist von den Top zehn Prozent die Rede, von etwa 100.000 Euro – senke die „Kosten des Scheiterns“. Dann werde schneller umgesteuert. Und aus schnellerem Umsteuern entstünden Innovation, Investitionen, Wohlstand.
Es ist die perfekte Erzählung für Politik und Medien: ein Hebel, eine Zielgruppe, eine Renditebehauptung. Der Reiz liegt nicht nur in der Einfachheit, sondern im impliziten Moralangebot: Wir tun nicht „irgendwas“, wir tun etwas für Innovation. Und wir tun es nicht „gegen alle“, sondern nur gegen jene, die man als robust genug ansehen kann, den Schutz zu verlieren. So wirkt Reform nicht wie Zumutung, sondern wie Modernisierung.
Nur ist der Kernfehler der Erzählung nicht moralischer Natur, sondern methodischer. Coste erklärt ein Entwicklungsproblem mit einer Durchschnittsvariable – und verfehlt damit das, was Entwicklung überhaupt ausmacht.
Costes blinder Fleck: die Sehnsucht nach dem Durchschnitt
Wer sagt „Top zehn Prozent“, sagt bereits: Durchschnitt. Die Kategorie ist kommunikativ praktisch, ökonomisch aber unerquicklich. Denn sie tut so, als ließe sich Innovationsrelevanz an einer Einkommensschwelle ablesen. Sie unterstellt, dass die entscheidenden Träger des Neuen dort sitzen, wo die Gehaltszettel am höchsten sind. In der Wirklichkeit ist das Segment heterogen: hochinnovative Spezialisten, ja; aber auch Stabilitätsfunktionen, Risiko- und Haftungsverantwortliche, Vertriebsschlüsselrollen, Compliance, Betrieb, kritische Infrastruktur. In vielen Branchen sind gerade die gut bezahlten Rollen nicht die, die Neues hervorbringen, sondern die, die das Bestehende unter Bedingungen hoher Komplexität verlässlich machen.
Das wäre kein Problem, wenn Costes Reform nur ein kleines, technisches Korrektiv wäre. Er verkauft sie aber als Hauptschalter. Und genau hier lohnt sich der Blick auf Joseph Schumpeter – so, wie ihn Jesko Dahlmann in seiner Arbeit nicht als Schlagwortlieferant, sondern als Methodiker rekonstruiert.
Schumpeter setzt auf methodologischen Individualismus: Kollektive Phänomene werden aus dem Handeln Einzelner nachvollziehbar. Vor allem aber warnt er vor der Ökonomenneigung, zu früh zu aggregieren. „Hütet euch vor Durchschnitten“ – dieser Satz ist bei Schumpeter keine Pointe, sondern eine Erkenntnisregel. Wer mittelt, verschleiert Unterschiede. Und wer Unterschiede verschleiert, erklärt am Ende Mechanismen weg.
Costes Argumentation ist genau so eine Durchschnitterzählung: Kosten runter, Innovation rauf. Nur dass Innovation nicht als statistische Reaktion auf einen Kostensatz entsteht, sondern als Ergebnis spezifischer Akteure, spezifischer Organisationen, spezifischer Konstellationen.
Das Schumpetersche Unternehmen: nicht Zweckrationalität, sondern Neues
Das zweite Missverständnis ist anthropologisch. Costes Vorschlag liest den Unternehmer implizit als Homo oeconomicus: als Kalkulierer, der die erwarteten Kosten eines Fehlschlags in seine Investitionsentscheidung einpreist. Wird der Exit günstiger, steigt das Wagnis. Das klingt plausibel, solange man Entwicklung für eine Form von Optimierung hält.
Schumpeter denkt anders. Sein Entrepreneur ist nicht der bessere Rechenknecht, sondern der Störer der Routine. Er realisiert neue Kombinationen – neue Produkte, neue Verfahren, neue Märkte, neue Organisationsformen. Und dieses Handeln folgt nicht primär der Zweckrationalität, sondern einem Motiv, das sich in der traditionellen Modellökonomik nur ungern abbilden lässt: dem Schaffen des Neuen als solchem. Der schumpeterianische Unternehmer „unterläuft“ das reine ökonomische Kalkül, weil er nicht nur reagiert, sondern initiiert, weil er nicht nur Konsequenzen zieht, sondern gestaltet.
Damit verschiebt sich die Frage: Wenn Entwicklung aus dem Durchsetzen des Neuen entsteht – warum sollte man ausgerechnet am juristischen Trennungsakt den Schlüssel suchen? Kündigungsregeln können Umsteuern erleichtern. Sie organisieren aber nicht das Neue. Sie ersetzen weder Durchsetzungskraft noch Kombinationsfähigkeit noch den Mut zur Abweichung innerhalb von Organisationen.
Coste behandelt die Ökonomie wie eine Maschine, die man über Reibungsreduktion schneller macht. Schumpeter behandelt sie wie ein Prozess, der aus Abweichungen entsteht. Das ist kein philosophischer Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen „effizienter werden“ und „anders werden“.
Schöpferische Unternehmer sind sozialer, als die Legende erlaubt
Genau hier wird Dahlmanns empirischer Zugriff zum Stachel gegen Costes Methodenkasten. Dahlmann verweist auf wirtschaftssoziologische Arbeiten (Euteneuer, Niederbacher), die nüchtern festhalten: Für Schumpeters Unternehmerbild gibt es erstaunlich wenige harte Belege; viele Hypothesen über Unternehmer werden theoretisch behauptet, aber empirisch nur dünn abgesichert. Die Konsequenz ist eindeutig schumpeterianisch: weniger Aggregat, mehr Fall. Wer verstehen will, muss hinsehen.
Dahlmann folgt dieser Logik und untersucht neun Persönlichkeiten der zweiten industriellen Revolution entlang der Schumpeter-Kriterien. Und die Ergebnisse passen schlecht zu einem modernen Reflex, der Innovation gern als Härteübung erzählt: Die von Dahlmann analysierten Unternehmer zeichnen sich durch außergewöhnliches soziales Engagement aus. Frühe Versorgungseinrichtungen, Sozialkassen, Arbeitszeitreduktionen, Zusatzvergütungen, betriebliche Fürsorge – keine Randnotizen, sondern wiederkehrende Muster.
Das ist entscheidend, weil es Innovation aus einer anderen Perspektive erklärt: nicht als Produkt maximaler Austauschbarkeit, sondern als Produkt organisationaler Bindung. Wer Neues durchsetzen will, braucht Loyalität, Vertrauen, interne Stabilität – gerade weil der Versuch des Neuen den Betrieb stört. Dahlmanns Zuspitzung bringt es auf den Punkt: Diese Unternehmer waren mehr Schöpfer als Zerstörer; ihre Innovationen ersparten den Unternehmen den aussichtslosen Kampf, immer nur kostengünstiger sein zu müssen. Sie suchten langfristige Wettbewerbsvorteile über bessere Produkte und neue Techniken – nicht über kurzfristige Gewinnexzesse, die man durch Personalpolitik herstellt.
Und damit steht Costes Reformvorschlag in einem paradoxen Licht: Er will Innovationsmut erzeugen, indem er den Schutzrahmen für eine Einkommensgruppe reduziert. Doch wenn empirisch gerade jene Unternehmer, die wirklich Bahnen verschoben, auffällig oft soziale Ordnung aktiv gestalteten – warum sollte Entsicherung der Königsweg sein?
Bedingungen für Innovationskraft
Welche Akteure, welche Organisationsformen, welche Anreizsysteme ermöglichen heute das schöpferische Gestalten? Es ist eine Liste von Bedingungen: schnelle Team- und Projektmobilität ohne biografische Strafzinsen, Weiterbildung im Übergang, Skalierungsmärkte, Beschaffung als erster Kunde, Finanzierungstiefe, Talentzuzug, Wohnraum, und eine Governance in Unternehmen, die experimentieren lässt, ohne dass jede Abweichung karrieregefährlich wird.
Gerade der letzte Punkt ist der unterschätzte: Innovation braucht nicht nur Risiko gegen außen, sondern Widerspruch nach innen. Sie braucht Menschen, die im System unbequem sein dürfen. Wer Austauschbarkeit politisch signalisiert, kann genau das Gegenteil erzeugen: weniger offenes Nein, mehr Absicherung, mehr Anpassung. Dann wird die Organisation nicht mutiger, sondern vorsichtiger – nur mit anderem Vokabular.
Coste hat ein Problem identifiziert – aber den falschen Hauptschalter
Man kann Coste zugestehen, dass er einen realen Schmerzpunkt adressiert: das langsame Umsteuern in großen europäischen Organisationen. Nur ist die daraus abgeleitete Monokausalität das eigentliche Risiko: Als könne man Entwicklung mit einem Paragraphen regieren. Als könne man aus einer Trennungserleichterung eine Schöpfungswahrscheinlichkeit machen.
Schumpeter – in der Dahlmann-Lesart – würde wohl erwidern: Wer aus Durchschnitten erklärt, verpasst die Mechanik. Wer Entwicklung will, muss die Bedingungen des Neuen organisieren. Das Neue entsteht nicht aus der Optimierung des Alten, sondern aus Akteuren, die Abweichung durchsetzen – und aus Organisationen, die diese Abweichung tragen.
Coste wird weiter durch Europas Flure gehen. Vielleicht wird sein Vorschlag irgendwann Gesetz. Aber selbst wenn: Ein Gesetz kann Trennung erleichtern. Es kann nicht erzwingen, dass jemand das Neue will. Und ohne dieses Wollen bleibt jede Reform das, was sie oft ist: ein sauberer Eingriff an der falschen Stelle.
Thema für die Zukunft Personal Nachgefragt Week vom 24. bis 27. Februar 2026
Wer nach Costes „ein Gesetz, ein Aufschwung“-Versprechen ein leichtes Unbehagen verspürt, sollte es sich merken: Diese Lust an der Monokausalität ist kein Ausrutscher, sie ist ein Muster – ungefähr so ausgeprägt wie in der jüngsten Arbeitsmoral-Debatte um Friedrich Merz, in der aus Krankenstand und Tele-AU gern ein einzelner Hebel gemacht wird. Genau deshalb passt der nächste Schritt besser in ein Forum als in die nächste Talkshow: Bei der Zukunft Personal Nachgefragt Week könnten wir das unmittelbar vertiefen – am Freitag, 27.02.2026, 10:00–10:45 Uhr, in der Session von Guido Zander („Zu oft krank, zu wenig Arbeit?“). Denn dort geht es – wie bei Coste – um die entscheidende Frage, die einfache Antworten meiden: Gesundheit, Verantwortung, Umsetzung – also darum, wie aus Insights Wirkung wird, ohne dass man komplexe Ursachen zu einem bequemen Sündenbock zusammenschmilzt.