
Drei mehr oder weniger ältere Herren (bin ja auch schon alt) diskutieren engagiert über das Fediverse – und was sie alles tun müssten, um die jungen Leute von TikTok in eine dezentrale Parallelwelt aus Pixelfed, Mastodon und sonstigen Retro-Inseln zu überführen. Die Analyse klingt überzeugend, der Ton ist dringlich, der Habitus: ein wenig ratlos, ein wenig rettend.
Man hat das Gefühl, als stünde das Fediverse kurz vor dem Renteneintritt, ohne je jugendlich gewesen zu sein. Das, was hier als Lösung propagiert wird – öffentliche Mediatheken, Unis, Forschungseinrichtungen als Träger einer digitalen Erweckungsbewegung – riecht nach Verwaltungsinnovation. Es ist die kulturelle Strategie der Broschüre: sauber gefalzt, nie gelesen.
Natürlich stimmt es: Kommerzielle Plattformen zersetzen Debattenkultur, algorithmische Tribalismen befeuern Polarisierung, Big Tech agiert jenseits demokratischer Kontrolle. Aber die Antwort darauf kann doch nicht sein, dass man versucht, mit E-Mail-Analogien und Login-Kooperationen das Fediverse zur Pflichtveranstaltung für Studierende zu erklären.
Wer glaubt, man könne ein digitales Ökosystem durch akademische Single-Sign-On-Lösungen in die Breite bringen, hat aus der Geschichte der Popkultur wenig gelernt. Das Internet wurde nicht groß, weil man es von oben plante. Es wurde groß, weil es anziehend war. Verführerisch. Chaotisch. Frech. Und: weil man dort sein wollte. Nicht, weil die Hochschule es bereitgestellt hatte.
Die Missionierung des Fediverse durch Hochschulen, öffentlich-rechtliche Mediatheken und EU-Prototypenschmieden ist ein groß angelegtes Missverständnis von Reichweite. Wenn es nicht attraktiv ist, kommen die Leute nicht. Wenn es ein Missionierungsprojekt wird, bleiben sie weg.
„Wir haben nicht ewig Zeit“, sagt Leonhard Dobusch. Stimmt. Aber es wäre hilfreich, mit dieser Zeit nicht auch noch das letzte Restchen Charme zu verspielen. Ein dezentraler Marktplatz lebt nicht vom Regelwerk, sondern vom Gewusel. Vom Klang. Vom Humor. Vom Meme. Vom Dissens. Von der Lust am Anderen.
Solange das Fediverse als Projektionsfläche für digitaldemokratische Hoffnung dient – getragen von Universitäten, öffentlich-rechtlichen Thinktanks und Menschen mit viel Freizeit –, wird es immer wie eine Fortbildung in einem schlecht beleuchteten Seminarraum wirken. Vielleicht sollten wir erst einmal aufhören, das Netz retten zu wollen, und anfangen, es wieder zu beleben.
Ich halte es da mit meinem alten Grundsatz: Wenn etwas für mich interessant ist, wird es mich finden. Das Fediverse darf gern finden. Aber bitte nicht mit Mediathek-Login und EU-Case-Slider. Danke.
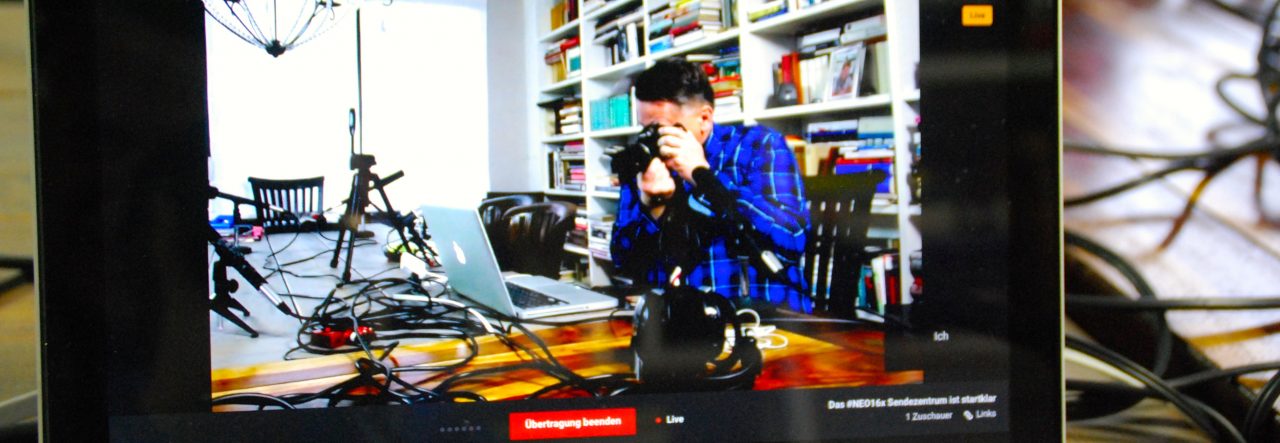
Ich glaube, wir sind gar nicht soweit auseinander. Du schreibst: „Das Internet wurde nicht groß, weil man es von oben plante. Es wurde groß, weil es anziehend war. Verführerisch. Chaotisch. Frech. Und: weil man dort sein wollte. Nicht, weil die Hochschule es bereitgestellt hatte.“
Was wir vorschlagen, ist doch genau das: keine zentral geplante Plattform von oben, sondern – wie das Internet! – von unten und dezentral. Chaotisch. Gern auch frech. (Aber: weniger Hass und Hetze, das ja. Denn das macht die derzeitigen Plattformen für viele Leute zunehmend unbenutzbar.)
In einem Punkt habe ich die Geschichte anders in Erinnerung (auch im Podcast angesprochen): das Internet entstand an Unis und die Leute waren drin, weil es an Unis einfach da war. Übrigens entwickelt und propagiert von irgendwelchen Nerds. Absolut nischig. Nicht-kommerziell.
Lieber Leonhard,
vielleicht sind wir wirklich nicht so weit auseinander – aber ich glaube, wir reden über zwei sehr unterschiedliche Formen von Anziehung.
Du sprichst von technischer Infrastruktur, die vorhanden war – ich spreche von einem kulturellen Magnetfeld, das daraus trotzdem erst entstehen musste. Die Unis hatten das Netz, ja. Aber das allein hat keinen Sog erzeugt. Der entstand, als das Netz wild wurde. Als es unberechenbar, anarchisch, widerspenstig war. Als es nach mehr roch als nur nach Möglichkeit.
Wenn du jetzt sagst: „Wie das Internet – dezentral, frech, offen“, dann frage ich zurück: Wo ist dieser Sog im Fediverse? Da sind ne Menge Spießer mit CB-Funk-Charme unterwegs und Zeitgenossen mit dem direkten Draht zum Ordnungsamt.
Vielleicht liegt es daran, dass wir heute keine technische Knappheit mehr haben – sondern eine Aufmerksamkeitsökonomie, in der Bedeutung nicht durch Verfügbarkeit entsteht, sondern durch kulturelle Resonanz. Und die lässt sich nicht über Fördermittel, Hochschulen oder Mediatheken erzeugen – so dezentral sie auch agieren mögen. Also die Frage dem Propheten und dem Berg….
Die Nerds von damals haben das Netz nicht geplant – sie haben es entfesselt.
Was wir heute brauchen, ist nicht die Infrastruktur des Fediverse – sondern seine Verführungskraft. Und die entsteht nicht im Code, sondern im Chaos.
Pingback: Technik ist nicht genug – das Internet war nie ein Verwaltungsakt #Fediverse - ichsagmal.com
Kommentar von Stefan: Yes, Sir. Technik ist wichtig, aber nicht genug. Und das kann man im Gespräch mit Leonhard Dobusch nachhören und in unzähligen Beiträgen (nicht nur) in meinem Blog nachlesen. Wir brauche interessante Inhalte und relevante Player. Das können die Universitäten und Forschungseinrichtungen sein. Die Öffnungen der Mediatheken wäre ein weiterer wichtiger Schritt. Beides Vorschläge von Leonard Dobusch, die ich ausdrücklich begrüße. Ich habe immer wieder gefordert, dass zum Beispiel Verlage mal ihre Chance begreifen sollte, aber die kämpfen Kämpfe des 19. Jahrhunderts und ziehen lieber ihre Paywalls hoch.
Wir kennen und schätzen uns (denke ich): Was mir extrem auf den Senkel geht, ist dass viele Internet-Vordenker und -Fuzzis nur über das Fediverse, die Fedi-Polizei und was weiß ich nicht rum mosern und sich konstruktiver Beteiligung am Fediverse verweigern, statt angesichts von Trump, Musk und Zuckerberg sich genau jetzt zu engagieren. Das wäre genau jetzt die richtige Reaktion. Aber lieber wir gemotzt.
Und da schließt sich der Kreis: Genauso war es auch, als das Internet entstand, dezentral mit Engagement vieler, die irgendwann den Nutzen verstanden haben. Um den Nutzen zu verstehen, müssen wir alle gemeinsam begeistern.
Pingback: Digitale Souveränität ist keine Stilfrage - ichsagmal.com