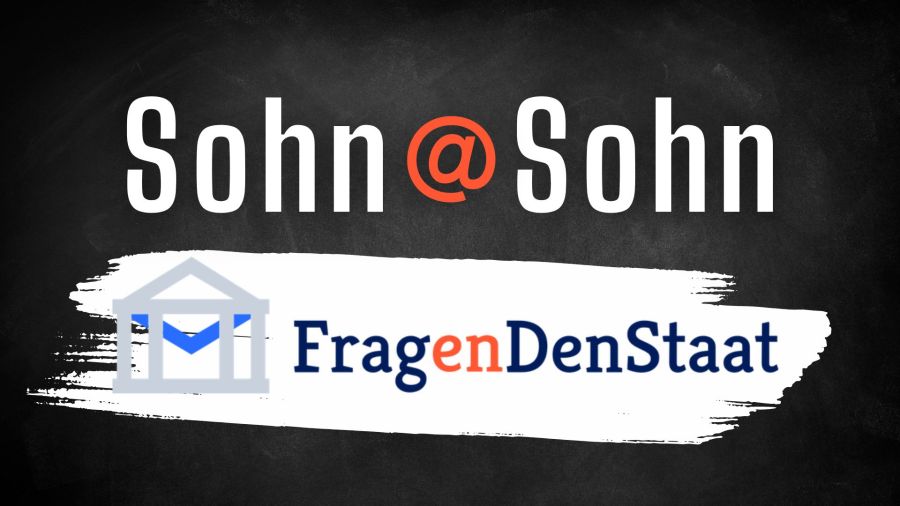„Wie fragt man den Staat? Was fragt man den Staat? Inkl. Action!“ – als dieses Motto am 2. Mai 2012 auf der re:publica als Workshop-Ansage stand, klang es noch nach demokratischer Bastelanleitung: ein bisschen Plattform, ein bisschen Formulierungshilfe, dann flutscht der Informationszugang schon.
Dreizehn Jahre später ist aus der Bastelanleitung ein Diagnoseinstrument geworden: Nicht die Frage, ob man fragen darf, ist das Problem – sondern wie der Staat lernt, nicht zu antworten, ohne „Nein“ zu sagen.
Genau diesen Punkt trifft der Freiburger Staatsrechtslehrer Friedrich Schoch in seinem FAZ-Gastbeitrag zum 20-jährigen Jubiläum des Informationsfreiheitsgesetzes: Das IFG war ein Fortschritt, aber es bleibt ein System begrenzter Transparenz – und ein System, das politisch jederzeit wieder kleiner gemacht werden kann.
Was an der Schoch-Analyse so nützlich ist: Er schreibt nicht aus dem Aktivistenreflex, sondern aus der Kombination von Lehrstuhl und Gerichtspraxis. Gerade dadurch wird sein Text zur Steilvorlage, um meine 2012er Recherchen (Insider-Infos einer Pressesprecherin im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums, Abwehrleitfäden, Gebühren-Drohkulisse) als das zu lesen, was sie waren: eine Feldstudie über die Exekutive im Abwehrmodus.
Die große Verheißung: Jedermannrecht ohne Begründung – und doch mit Haken
Das IFG startete mit Pathos: Jeder hat Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Schoch erinnert daran, dass es damit in Deutschland einen Bruch mit dem alten Prinzip „Akten nur bei berechtigtem Interesse“ gab – und dass das Gesetz ausdrücklich Demokratie, Meinungsbildung und Kontrolle stärken sollte.
Meine 2012er Bilanz dagegen klingt wie das Protokoll aus einer Behörde, die den neuen Anspruch als Störung des Betriebsfriedens behandelt: Gummiparagrafen, Abwimmelroutinen, Gebühren als Abschreckung. Das Gesetz verspricht Offenheit als Standard – die Verwaltung behandelt Offenheit als Ausnahmefall, der begründet werden muss.
Schoch liefert dafür die juristische Innenansicht: Es gibt legitime Geheimhaltungsgründe – aber das IFG arbeitet teils mit absoluten Ausschlussgründen (ohne Abwägung), mit Bereichsausnahmen (z. B. Nachrichtendienste), und mit einem Schutz privater Interessen (u. a. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse), der in der Praxis sehr weit reicht. Fast die Hälfte der Paragrafen kann benutzt werden, um Bürgerinnen und Bürger wieder loszuwerden.
Die Abwehr ist die Botschaft: „Öffentliche Sicherheit“ als Blackbox
Der klassische Abwehrsatz heißt: „Die Veröffentlichung gefährdet die öffentliche Sicherheit.“ Das klingt nach Terrorlage, endet aber manchmal bei peinlich profanen Dingen – etwa Namen.
Das ACTA-Beispiel ist bis heute die perfekte Miniatur dafür: Eine IFG-Anfrage wollte wissen, wer für die Bundesregierung an ACTA-Verhandlungsrunden teilnahm; abgelehnt wurde u. a. mit Verweis auf „öffentliche Sicherheit“, weil die betroffenen Personen potenziell Angriffen ausgesetzt sein könnten – und weil FragDenStaat Veröffentlichung ermöglicht. Und dann passiert etwas Interessantes: Die Abwehr produziert Öffentlichkeit. Ein Spendenaufruf macht die Gebührenangst kollektiv finanzierbar – „7000 Euro“ tauchen als Symbol dafür auf, dass Transparenz in Deutschland oft erst dann real wird, wenn Bürger sie crowdsourcen.
Das ist der Punkt, an dem du Susanne Gaschkes „totalitäre Transparenz“-Warnung elegant drehen kannst: Totalitär ist hier nicht Transparenz, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der der Staat Transparenz als Risiko framet. Die politische Schieflage ist nicht „zu viel Öffentlichkeit“, sondern zu viel Deutungshoheit der Verwaltung darüber, was Öffentlichkeit „gefährdet“.
Der Trick mit dem Medium: Wenn Akten digital werden, wird Transparenz optional
Schoch setzt noch einen zweiten, modernen Hebel drauf: Die elektronische Kommunikation droht das IFG zu unterminieren, weil Ministerien Chats, Direktnachrichten und „informelle“ Kanäle aus der Aktenwelt herausdefinieren (TwitterX-DMs als „bagatellartig“, Wire-Nachrichten als „privat“). Er nennt das juristisch unhaltbar und politisch brandgefährlich: Wenn sich Regierungshandeln in Kanäle verlagert, die nicht als „amtliche Information“ gelten, entsteht Transparenzverweigerung durch Aktenvermeidung.
Meine 2012er Insider-Informationen bekommen dadurch eine neue Aktualität: Früher war die zentrale Technik „Ablehnen mit Paragraf“. Heute kommt „Nicht-Aufzeichnen“ dazu – die modernste Form des Abwimmelns ist das Verschwindenlassen der Spur.
Der Staatstrojaner als Lehrstück: Die Wunschliste ist politischer als der Einsatz
In Überwachungsfragen wird politisch gern über den konkreten Einsatz gestritten; mein Blick richtet sich auf Beschaffung, Leistungsbeschreibung, Abnahme, Rechnung.
Der Bericht des damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten (Peter Schaar) dokumentiert 2012 zur Quellen-TKÜ beim BKA den DigiTask-Rahmenvertrag und die bemerkenswerte Klammer: „Grundmodul inkl. Skype“ – und das Modul „Onlinedurchsuchung“ sei „im Preis enthalten“ und könne „bei Bedarf integriert werden“. Ob ein Modul angeblich nie „abgerufen“ wurde, wird so zur semantischen Debatte – während die eigentliche demokratische Frage lautet: Was wurde strukturell einkaufbar gemacht? Der Skandal beginnt nicht beim Klick, sondern beim Warenkorb.
„Mehrwert“ – das freundlichste Codewort für Rückbau?
Schoch endet nicht euphorisch: Der Fortbestand des IFG sei politisch nicht gesichert; Reformbedarf gebe es, aber die Richtung sei offen. Und dann steht da dieser Satz aus dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: Man wolle das IFG „in der bisherigen Form mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung reformieren“.
Das Wort „Mehrwert“ ist in diesem Kontext so harmlos, dass es gefährlich wird. Denn die Vorgeschichte war lauter: In den Verhandlungen stand zeitweise im Raum, das IFG in seiner bisherigen Form abzuschaffen – nach Protest aus Medien und Gesellschaft wurde daraus die weichgespülte „Mehrwert“-Formel.
Mehrwert für wen – für Antragsteller oder für die Behörde?
Mehrwert für die Verwaltung kann nämlich auch heißen: mehr Ausnahmen, mehr „Unverhältnismäßigkeit“, mehr Gebühren, mehr formale Hürden. Also: ein IFG, das sich demokratisch gibt, aber administrativ entkernt.
Schochs Reformvorschläge zeigen, wie „Mehrwert“ anders aussehen müsste: weniger Ausnahmen durch Überschneidungen, weniger absolute Verweigerungsgründe, mehr Abwägung wie im Umweltinformationsrecht, keine pauschalen Bereichsausnahmen ohne Begründungs- und gerichtliche Kontrollfähigkeit.
Wie man den Staat fragt, ohne in die Abwehrmaschine zu laufen
Frag nach Dokumenten, nicht nach Meinungen. („Bitte übersenden Sie…“, nicht „Bitte erklären Sie…“).
Begrenze sauber: Zeitraum, Organisationseinheit, Dokumenttypen.
Verlange Teilzugang: „Sofern einzelne Passagen schutzbedürftig sind, bitte ich um Schwärzung und Herausgabe des übrigen Teils.“
Kostenkontrolle: „Bitte informieren Sie mich vorab, falls Gebühren anfallen, und beziffern Sie diese.“ (damit §10 nicht als Überraschungskeule kommt).
Spur sichern: „Bitte berücksichtigen Sie auch elektronische Kommunikation, soweit sie dienstlich veranlasst ist.“
Transparenz ist keine Ideologie – sie ist Rechenschaft
Schochs stärkster Satz steht zwischen den Zeilen: Verwaltung und Regierung üben Herrschaftsmacht aus; wenn Vorgänge sichtbar werden, ist das keine Zumutung, sondern demokratische Normalität.
Meine 2012er Pointe – „besser mit der Kunst des Abwimmelns beschäftigen“ – wird damit zur 2026er Agenda: Nicht weil wir Transparenz vergöttern, sondern weil wir Rechenschaft brauchen, wo Macht ausgeübt wird.
Siehe auch: