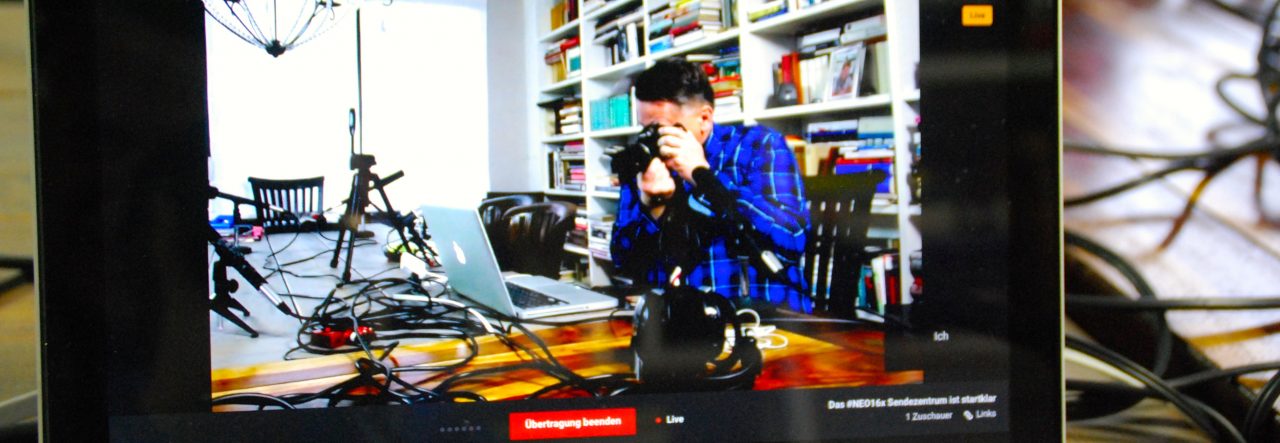Worte sind in der Sicherheitspolitik nie bloße Etiketten. Sie sind Ankündigungen, manchmal Drohungen, oft Beruhigung. Als der Verteidigungsminister im Herbst 2023 öffentlich verlangte, Deutschland müsse „kriegstüchtig“ werden, war die eigentliche Provokation nicht der militärische Sachgehalt, sondern der Bruch mit einer politischen Sprachregelung, die „Krieg“ seit Jahrzehnten wie eine ansteckende Krankheit mied.
Man kann darüber streiten, ob der Begriff klug gewählt ist. Aber man sollte ihn nicht missverstehen: Gemeint ist – jedenfalls in verantwortlicher Lesart – nicht Lust am Konflikt, sondern die Fähigkeit zur Abschreckung; also die Fähigkeit, einen Gegner davon abzuhalten, uns zu prüfen. Wer Abschreckung verwechselt mit Säbelrasseln, hat noch nicht verstanden, wie zerbrechlich Frieden ist. Frieden ist kein Naturzustand. Er ist ein politisches Werkstück, das gepflegt werden muss – durch Diplomatie, durch Bündnisse, und notfalls durch die glaubwürdige Möglichkeit, Gewalt abzuwehren.
Die Frage, ob die deutsche Öffentlichkeit „kriegstauglich“ sei, ist deshalb doppelt falsch gestellt. Erstens, weil eine Demokratie nicht „kriegstauglich“ sein darf wie eine Kaserne; sie muss konfliktfähig bleiben, streitbar, zweifelnd, parlamentarisch. Zweitens, weil die entscheidende Frage nicht lautet, ob Menschen bereit sind zu sterben, sondern ob Politik, Staat und Gesellschaft bereit sind, die Voraussetzungen zu schaffen, damit niemand sterben muss.
Das demoskopische Paradox: Zustimmung im Abstrakten, Zögern im Konkreten
Die Umfragen der letzten Jahre zeichnen ein Bild, das man weder dramatisieren noch beschönigen sollte: breite Zustimmung zu mehr Verteidigungsfähigkeit – bei gleichzeitig geringer persönlicher Kampfbereitschaft.
So befürworteten in einer Forsa-Erhebung im Sommer 2025 zwei Drittel höhere Verteidigungsausgaben; auch ein verpflichtender Wehrdienst fand – unter Bedingungen – Mehrheiten. Gleichzeitig sagten nur 16 Prozent, sie würden Deutschland „auf jeden Fall“ mit der Waffe verteidigen; weitere 22 Prozent „wahrscheinlich“, eine Mehrheit jedoch eher nicht.
Das ist kein moralisches Versagen der Bevölkerung. Es ist ein Hinweis auf eine lange eingeübte Arbeitsteilung: Sicherheit als Dienstleistung des Staates, nicht als Bürgeraufgabe. Diese Mentalität entstand nicht zufällig, sondern im Schatten einer historischen Erfahrung: Deutsche haben gelernt, dass Militarisierung ins Verderben führen kann. Daraus wurde – durchaus verständlich – eine Kultur der Distanz. Nur: Distanz ist kein Schutzschild gegen einen Gegner, der unsere Zurückhaltung als Einladung missversteht.
Zeitenwende verstanden – aber nicht verinnerlicht
Ein zweiter Befund ist ebenso wichtig: Bedrohungswahrnehmung ist vorhanden, aber politisch nicht stabil.
In der Bevölkerungsbefragung 2025 des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) sahen etwa zwei Drittel Russland als Bedrohung für Deutschlands Sicherheit; besonders genannt wurden Cyberangriffe, russische Aufrüstung und das militärische Vorgehen in der Ukraine. Zugleich zeigte dieselbe Befragung, dass 58 Prozent eine aktive deutsche Rolle in Krisen befürworten – aber 34 Prozent plädieren dafür, sich eher herauszuhalten.
Dieses Drittel ist kein Randphänomen. Es ist die demografische Basis jener Indifferenz, die wächst, sobald das Gefühl unmittelbarer Gefahr nachlässt. Das ist menschlich – und politisch gefährlich. Denn Sicherheitsvorsorge funktioniert nicht wie Feuerwehr: Man kann sie nicht erst dann ernst nehmen, wenn es schon brennt.
Hinzu kommt eine strategische Unruhe, die in Umfragen greifbar wird: Das Vertrauen in die USA als verlässlichen Bündnispartner sank in der ZMSBw-Befragung 2025 deutlich; zugleich nahm die Sorge um den Zusammenhalt der NATO zu. In einer solchen Lage wird Europa nicht „mehr Militarismus“ brauchen, sondern mehr Verantwortungsfähigkeit – und zwar in einem nüchternen Sinne: eigene Fähigkeiten, eigene industrielle Kapazitäten, eigene Resilienz.
Ukraine: Zustimmung, Ermüdung, Spaltung – und die Pflicht zur Ehrlichkeit
Die öffentliche Meinung zur Unterstützung der Ukraine zeigt, wie fragil Mehrheiten sein können, wenn Ziele unklar bleiben.
Eine ZDF-„frontal“-Umfrage Anfang 2025 fand eine Mehrheit für Waffenlieferungen, mit Ost-West-Unterschieden; auch eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen europäischen Absicherung einer Waffenruhe fand Zustimmung – wiederum mit deutlichen regionalen Differenzen. Eine Ipsos-Umfrage im Januar 2025 meldete dagegen: 48 Prozent wollten keine weiteren Waffenlieferungen; im Osten war die Ablehnung deutlich höher als im Westen.
Wer daraus nur „Verwirrung“ liest, unterschätzt die Logik demokratischer Meinungsbildung: Menschen fragen – zu Recht – nach Zweck, Risiko und Aussicht auf Erfolg. Wenn Politik diese Fragen mit moralischen Appellen ersetzt, statt sie zu beantworten, verliert sie Vertrauen. Und ohne Vertrauen ist weder Abschreckung glaubwürdig noch zivile Resilienz organisierbar.
Lektionen aus dem Balkan: Wie schnell Zustimmung kippen kann – und warum
Sie verweisen auf eine empirisch gut untersuchte Erfahrung aus dem Jugoslawien-Krieg – und dieser Rückblick ist mehr als Historie. Er ist Warnung.
Die von meiner verstorbenen Ehefrau Miliana Sohn vorgelegte Untersuchung zeigt, wie stark Meinungen in kurzer Zeit beweglich werden können, wenn politische Deutung, mediale Rahmung und moralische Dringlichkeit zusammenfallen. In den erhobenen Daten wird etwa sichtbar, dass im April 1999 68 Prozent die völkerrechtlich nicht legitimierten NATO-Luftangriffe als „richtig“ bewerteten – obwohl zugleich in der öffentlichen Debatte erhebliche Zweifel an Recht und Zweckmäßigkeit existierten. pdf Jugoslawien Krieg
Ebenfalls herausgearbeitet wird die Tendenz, dass Berichterstattung unter den Bedingungen moderner Kriege (Informationsasymmetrien, eingeschränkte Recherchemöglichkeiten, emotionale Bilder) leichter in Richtung „Sprachrohr“ einer Konfliktpartei kippen kann – und damit Urteilsfähigkeit durch Erregung ersetzt.
Die Lehre daraus ist unbequem: Überzeugungsarbeit ist notwendig, aber sie ist gefährlich, wenn sie zur Mobilmachung ohne Maß wird. Der Staat darf nicht Propaganda betreiben; er muss erklären. Und er muss Zweifel aushalten – gerade weil Zweifel der Preis der Freiheit ist.
Bevölkerungsschutz ist keine Nebensache, sondern die innere Seite der Abschreckung
Wer heute nur über Panzer, Munition und Brigadepläne spricht, versteht das 21. Jahrhundert nicht. Die Verwundbarkeit moderner Gesellschaften liegt in Netzen: Strom, Kommunikation, Logistik, Gesundheit, Wasser, Daten.
Gerade in diesen Tagen kann man das konkret beobachten: Anfang Januar 2026 legte ein Brand an Hochspannungskabeln im Südwesten Berlins zehntausende Haushalte und Betriebe lahm – mit Folgen für Wärmeversorgung, Kommunikation und Pflegeeinrichtungen; die Ermittler bewerten den Vorgang als politisch motiviert.
Solche Ereignisse sind nicht bloß „Kriminalität“. Sie sind Stresstests für Staat und Gesellschaft – und sie zeigen, wie schnell aus Komfort Abhängigkeit wird.
Dazu passt, was die Forschung zum Bevölkerungsschutz seit Jahren sagt: Auf der Mikroebene – bei Vorräten, Wissen, Kompetenzen – gibt es Defizite, denen man mit Information und Weiterbildung begegnen müsse. Das BBK empfiehlt in seinem aktuellen Ratgeber, Haushalte sollten sich im Idealfall für rund zehn Tage selbst versorgen können; zumindest ein Grundvorrat für drei Tage sei ein sinnvoller Anfang. Wer solche Sätze belächelt, hat nicht verstanden, was Resilienz bedeutet: nicht Panik, sondern Handlungsfähigkeit. Und Handlungsfähigkeit entsteht nicht aus Angst, sondern aus Übung.
Was also tun? Drei Grundsätze für eine demokratische Sicherheitskultur
Erstens: Sicherheitspolitik braucht Klartext – ohne Übertreibung.
Der Satz „wir müssen kriegstüchtig sein“ kann nur dann verantwortbar sein, wenn er immer mit dem Zusatz gedacht wird: „um Krieg zu verhindern“. Das ist keine Rhetorik, sondern der Sinn von Abschreckung – und wurde so auch in parlamentarischen Debatten formuliert.
Zweitens: Bündnisfähigkeit nach außen verlangt Bürgerfähigkeit nach innen.
Mehr Geld, neue Strukturen, ein Wehrdienstmodell – all das kann notwendig sein. Aber es wird scheitern, wenn es nur als Verwaltungsreform betrieben wird. Die Umfragen zeigen: Zustimmung ist da, aber sie ist fragil und alters-/regionsabhängig. Genau deshalb braucht es eine ernsthafte, dauerhafte Sicherheitskommunikation – in Schulen, Kommunen, Medien, Verbänden – nicht als Kampagne, sondern als Bildung.
Drittens: Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Landesverteidigung gehören zusammen.
Der Staat selbst zieht diese Linie inzwischen deutlicher: Mit dem angekündigten „Pakt für den Bevölkerungsschutz“ sollten Milliarden in Warnsysteme, Schutzräume, Fahrzeuge und gemeinsame Übungen fließen – gerade auch gemeinsam mit Bundeswehr und Hilfsorganisationen.
Das ist richtig. Wer im Ernstfall funktionieren will, muss im Frieden gemeinsam üben. Und wer im Frieden nicht investiert, wird im Ernstfall improvisieren – mit vermeidbaren Opfern.
Schluss: Die eigentliche Zumutung der Zeitenwende
Die Zeitenwende fordert nicht, dass die Deutschen „kriegsbereit“ werden. Sie fordert, dass sie erwachsen werden in Sicherheitsfragen: weniger Illusion, weniger moralische Selbstberuhigung, mehr Verantwortung.
Eine demokratische Öffentlichkeit wird immer skeptisch bleiben – und das ist gut so. Aber Skepsis darf nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Gleichgültigkeit ist die Einladung an die Unvernünftigen dieser Welt.
Die Aufgabe der Politik ist daher nicht, die Bevölkerung zu „überreden“, sondern sie zu befähigen: durch Ehrlichkeit über Risiken, durch Klarheit über Ziele, durch Schutz der Infrastruktur, durch Stärkung von Bundeswehr und Bündnissen – und durch einen Bevölkerungsschutz, der den Namen verdient.
Denn am Ende ist „Kriegstüchtigkeit“ – wenn das Wort überhaupt einen Platz haben soll – nur dann legitim, wenn sie der Friedensfähigkeit dient.