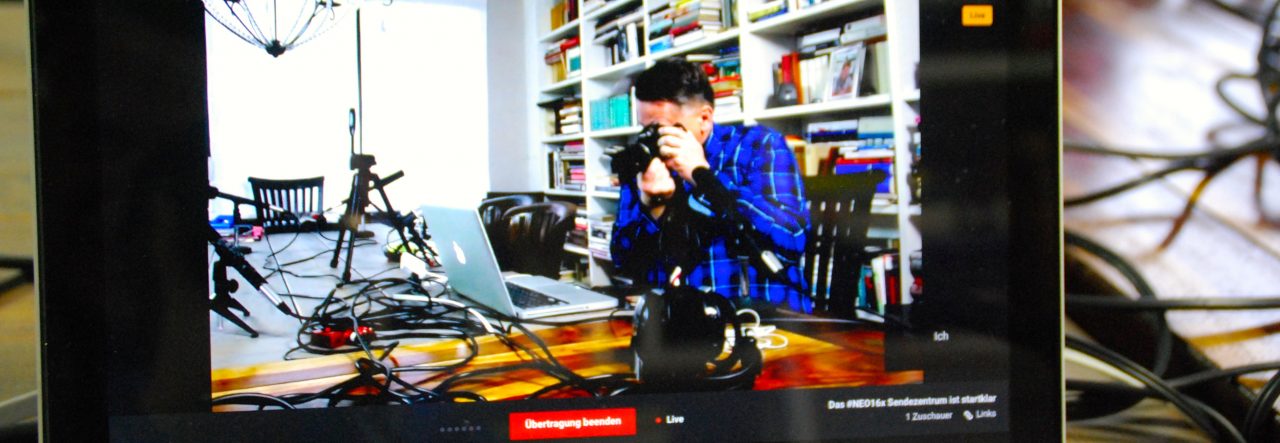Wer die politische Gegenwart verstehen will, muss inzwischen ebenso sehr auf die Formen achten wie auf die Inhalte. Dass der Bundeskanzler sein erstes großes Interview des Jahres 2026 nicht in einem klassischen Leitmedium platziert, sondern in einem Podcastformat, das sich nun unter eigener Regie präsentiert, ist mehr als ein PR-Detail. Es ist ein Indikator für eine veränderte Ordnung der Öffentlichkeit: Politik tritt nicht mehr bloß vor ein Publikum, sie richtet sich ihre Bühne selbst ein – mit eigener Dramaturgie, eigener Tonlage, eigener Community-Ökonomie.
Der Auftakt von „Machtwechsel“ nach der Ausgründung – Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander im Gespräch mit Friedrich Merz – ist deshalb nicht nur ein Interview, sondern eine Art Lagebild: außenpolitisch, europäisch, innenpolitisch. Merz spricht nicht wie ein Kanzler, der eine neue Welt entwirft, sondern wie einer, der eine alte Welt inventarisiert – und dabei feststellen muss, dass die Bestände schrumpfen.
Die transatlantische Semantik: Freundschaft als Ritual, Distanz als Pflicht
Schon die Einstiegsfrage nach „Freunden“ legt den Nerv frei. Merz weicht nicht aus, aber er entzaubert: In der Politik, sagt er sinngemäß, sei „Freund“ oft eine Floskel. Das klingt nach Nüchternheit, ist aber zugleich Selbstschutz. Denn wer „Freundschaft“ sagt, muss Enttäuschung erklären; wer „Interesse“ sagt, kann Brüche als Normalität verbuchen.
Interessant wird es dort, wo Merz den Applaus für den US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz kommentiert. Er beschreibt Standing Ovations nicht als Zustimmung zum Inhalt, sondern als Erleichterung über den Ton: Endlich wieder ein Amerikaner, der die Europäer rhetorisch als Partner adressiert. In diesem Satz steckt eine psychologische Diagnose, die schmerzt: Europa ist so sehr an die Zumutung gewöhnt, dass bereits Höflichkeit als politische Substanz missverstanden werden kann. Merz lässt erkennen, dass ihm das nicht reicht. Doch er bleibt zugleich im Rahmen dessen, was er für praktikabel hält: Distanz ohne Bruch, Kritik ohne Emanzipationspathos.
Nukleare Abschreckung: Das Unaussprechliche wird verwaltungstauglich
Der eigentliche Sprengstoff des Gesprächs liegt nicht in markigen Formeln, sondern in der Art, wie Merz über zuvor tabuisierte Fragen spricht. Europäische nukleare Abschreckung – vor wenigen Jahren noch ein Thema für Randzonen strategischer Debatten – erscheint hier als nüchterner Prüfauftrag. Merz schließt eine deutsche Atomwaffe aus, verweist auf den 2+4-Vertrag und den Atomwaffensperrvertrag, betont aber zugleich, man müsse mit Frankreich (und möglicherweise Großbritannien) ernsthaft über eine europäische Ergänzung des nuklearen Schirms sprechen.
Bemerkenswert ist die Technik: Merz dramatisiert nicht. Er spricht von einem „Berg“ ungeklärter Sach- und Rechtsfragen, von technischen Problemen, von Abstimmungsbedarf. Gerade diese Trockenheit ist politisch wirksam. Sie normalisiert. Das Tabu wird nicht gebrochen, es wird in Prozedur übersetzt. So verschiebt sich der Rahmen des Sagbaren – nicht durch revolutionären Gestus, sondern durch Verwaltungsrationalität.
FCAS und die europäische Rüstungsfrage: Europa scheitert im Lastenheft
Nichts illustriert die Grenzen europäischer Integration so präzise wie die Passage zum deutsch-französischen Kampfflugzeugprojekt FCAS. Merz beschreibt den Konflikt nicht als Machtkampf oder Verstimmung, sondern als Divergenz im „Anforderungsprofil“: Frankreich brauche Trägerfähigkeit und eine nukleare Option, Deutschland nicht. Darin liegt die ganze Tragik des europäischen Rüstungsversprechens. Was auf Gipfeln als „europäische Souveränität“ beschworen wird, scheitert im Lastenheft – also dort, wo die Realität beginnt.
Merz klingt hier nicht wie ein romantischer Europäer, sondern wie ein Kanzler, der sich die Kosten des Scheiterns nicht mehr leisten will. Sein Credo – Standardisierung, Vereinfachung, Skalierung – ist betriebswirtschaftlich plausibel und strategisch verständlich. Doch es berührt einen empfindlichen Punkt: Wer Europa in der Sicherheitspolitik stärken will, muss nicht nur Systeme bauen, sondern Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nicht aus Effizienzformeln, sondern aus der Bereitschaft, Abhängigkeit zu akzeptieren – gerade wenn sie weh tut.
Ukraine, Putin, Verhandlungen: Nüchternheit als Härte
In der Russland- und Ukrainepolitik wählt Merz einen Ton, der zugleich realistisch und unerquicklich ist. Er spricht von Verhandlungen, aber nicht im Sinne einer raschen Lösung. Sein Kernbefund lautet: Dieser Krieg endet, wenn eine Seite militärisch und/oder ökonomisch erschöpft ist. Das ist keine Drohung, sondern eine Diagnose. Doch sie hat Konsequenzen: Wer so spricht, gesteht ein, dass die Zeitachse offen ist und der Preis hoch bleibt.
Merz deutet außerdem an, die russische Volkswirtschaft stehe möglicherweise schlechter da, als man offiziell wisse. Das ist die klassische Kanzlerformel zwischen Hoffnung und Ungewissheit: genug Zuversicht, um Durchhalten zu legitimieren; genug Vorsicht, um später nicht an Prognosen gemessen zu werden. Auffällig ist dabei, dass Merz direkte Gesprächskanäle zum Kreml als erprobt und negativ beschreibt – und damit politisch immunisiert, was in anderen Konstellationen als „Gesprächsverweigerung“ kritisiert würde. Man kann das als Lernfähigkeit lesen. Man kann es auch als Verhärtung einer Lage interpretieren, in der Diplomatie ohne Machtmittel zur Geste verkümmert.
Innenpolitik als Schutzversprechen: Social Media, Klima, Arbeit
Überraschend – und politisch nicht ungeschickt – ist Merz’ Offenheit für Altersgrenzen oder restriktivere Regeln bei Social Media. Er argumentiert nicht kulturkämpferisch, sondern sozialpsychologisch: Sozialisation, Bildschirmzeiten, Persönlichkeitsbildung, die neue Qualität von Desinformation durch KI. Seine Pointe, man könne Kinder nicht mit dem Argument an riskante Medien heranführen, man würde sonst „auch Alkohol“ frühzeitig ausgeben, setzt bewusst einen Reiz. Hier spricht nicht der reine Liberale, sondern ein Konservativer, der Schutz als Voraussetzung von Freiheit formuliert. Das ist ein Bruch mit Teilen der eigenen Instinkte – und zugleich ein Versuch, gesellschaftliche Mitte neu zu definieren: weniger über Abwehr von Regulierung, mehr über Begrenzung von Zumutungen.
Auch in der Klimapolitik zeigt Merz die Linie: Er verteidigt den europäischen Emissionshandel als marktwirtschaftliches Instrument und verweist auf dessen bisherige Erfolge – will aber verhindern, dass Klimapolitik zur staatlichen Einnahmequelle wird. Daraus entsteht die nächste große Konfliktzone: Das System wirkt erst dann, wenn es spürbar wird. Und spürbar wird es beim Verbraucher. Merz setzt darauf, dass Ausweichmöglichkeiten und Rückverteilungsmechanismen die politische Akzeptanz sichern. Doch die Erfahrung der letzten Jahre lehrt: Akzeptanz ist volatil, Empörung schneller als Planung, Kampagnen effektiver als Erklärung.
In der Debatte um Arbeitszeit und Wohlstand schließlich zeigt sich Merz’ Grundmelodie: Leistung, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit. Er klagt nicht an, aber er insistiert. Das ist klassisch bürgerlich – und zugleich riskant, weil es in einer angespannten sozialen Lage schnell als moralische Zurechtweisung gelesen wird. Merz scheint das zu wissen; er verweist auf Verkürzungen und bewusste Verdrehungen. Doch der Hinweis allein schützt nicht vor dem Mechanismus.
Europa und Schulden: Das kategorische Nein als Selbstbindung
Am härtesten wirkt Merz beim Thema gemeinsamer europäischer Verschuldung. Er verweist auf vorhandene EU-Schuldeninstrumente, lehnt darüber hinausgehende Schritte ab und begründet dies mit Haftungslogik, fehlender europäischen Staatlichkeit und dem Risiko für Deutschlands Kreditrating. Auffällig ist, dass er sogar das übliche Hintertürchen („nie nie“) vermeiden will. Das ist entweder Prinzipientreue – oder eine kalkulierte Selbstbindung, um gar nicht erst in die Dynamik europäischer Erwartung zu geraten.
Das Problem: Merz selbst weiß, dass Krisenpläne oft an der nächsten Krise zerschellen. Er sagt, niemand wisse, was morgen kommt. Genau darin liegt die Spannung: Wer kategorisch ausschließt, muss später entweder standhaft bleiben – oder umso drastischer begründen, warum er es nicht blieb. Die Zeit, in der ein Kanzler Kurswechsel als „staatspolitisch geboten“ verkaufen konnte, wird kleiner. Das Gespräch verrät, dass Merz diese neue Härte der Öffentlichkeit sehr genau spürt.
Was bleibt: Ein Kanzler, der den Rahmen verschiebt – ohne ihn zu sprengen
Dieses Interview ist weniger ein Feuerwerk als eine Vermessung. Merz markiert Korridore: zur nuklearen Frage, zur europäischen Rüstung, zur Klimapolitik, zur digitalen Regulierung, zur EU-Finanzarchitektur. Er tut es ohne Pathos, in einem Ton kontrollierter Nüchternheit. Das verleiht Autorität – und entzieht zugleich Angriffsflächen.
Doch gerade diese Nüchternheit hat eine Nebenwirkung: Sie kann den Eindruck erzeugen, Politik sei vor allem Verwaltung von Unausweichlichkeiten. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Merz kluge Punkte setzt. Die Frage ist, ob aus diesen Punkten eine Erzählung entsteht, die trägt: eine Begründung dessen, was den Bürgern zugemutet wird – und warum. Denn die Republik, die Merz beschreibt, ist nicht nur gefährdet durch äußere Bedrohungen. Sie ist gefährdet durch die innere Gewöhnung, dass Entscheidungen zwar getroffen, aber nicht mehr plausibel gemacht werden.
Wenn „Machtwechsel“ unter eigener Regie mehr sein will als ein neues Hinterzimmer, dann liegt seine Aufgabe genau hier: nicht nur Entscheidungen abzubilden, sondern ihren Preis sichtbar zu machen – bevor er als nächste Rechnung kommt.